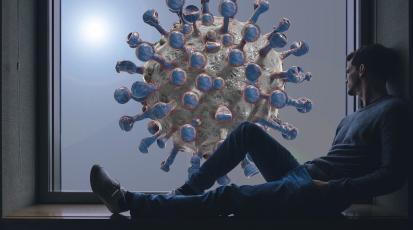Die Außenverkleidung des Rettungswagens wackelt, während das Blaulicht grell durch die Fenster flackert, der Motor wie ein Ungeheuer unter mir dröhnt und das Martinshorn mich bis ins Mark durchdringt. Ich erlebe auf dieser Fahrt wohl das, was man eine Existenzkrise nennt. Panisch blicke ich um mich, um dann durch das kleine Schiebetürchen hinter mir in das Fahrerhäuschen Kontakt zu meiner Schwester zu suchen, die angehende Notfallsanitäterin ist.
Ich reagiere äußerst sensibel auf diese Situation und bin deshalb eine gute Vertreterin der Generation Z.
Die mentale Belastung der Generation Z, zu der die Jahrgänge 1995 bis 2009/2010 zählen, steigt laut einer aktuellen Jugendstudie. Fast jeder Neunte ist in diesem Alter wegen psychischer Störungen in Behandlung. Doch spiegelt diese steigende Zahl eine generelle Schwäche der Generation wider oder zeigt sie vielmehr eine neue Form der Sensibilität, sich Hilfe zu suchen, die bei früheren Generationen weniger ausgeprägt war? Diese Fragen will ich im Laufe meiner Schicht im Rettungswagen erforschen und am Beispiel von mir und meiner Schwester über unsere Generation nachdenken.
4.05 Uhr. Irgendwas bimmelt unüberhörbar und zu einer menschenverachtenden Zeit. Was zur Hölle ist das? Verwirrt blicke ich in das dunkle Zimmer. Dann trifft es mich wie ein Blitz: Heute startet mein Selbstversuch! Schlagartig wach, springe ich aus dem Bett, ziehe mich hastig an und eile ins Esszimmer. Dort sitzt meine Schwester Sophia, noch halb schlafend, mit einem heißen Kakao in der Hand. Ich hingegen bin ein wandelndes Adrenalinbündel und kann kaum stillsitzen. Der Kaffee, den ich mir schnell hinunterkippe, tut sein Übriges. Schließlich nickt sie mir zu und wir laufen zum Auto.
Die kühle Luft der Nacht umhüllt mich, während tausend Gedanken wie Tischtennisbälle durch meinen Kopf schießen. Mühsam versuche ich, das Gedankenkarussell zu stoppen, als wir die Rettungswache erreichen.
Viel Zeit, alles auf mich einwirken zu lassen, bleibt nicht, denn die Schicht beginnt gleich. Zuvor bekomme ich die übliche Montur: knallorange Hose, passende Jacke, blaues Shirt und schwarze Stiefel.
Ebenfalls wichtig: der Melder. „Auf den Melder bekommen wir die Einsätze von der Integrierten Leitstelle zugeteilt“, erklärt Sophia mir. Das kleine, kaum handflächengroße Gerät, das Menschenleben retten soll, befestige ich an meinem Gürtel.
Bei der Übergabe im Aufenthaltsraum fliegen die medizinischen Fachbegriffe der Schicht vor uns nur durch den Raum. Es ist ein unfassbarer Trubel am frühen Morgen. Ich bin zwar ein Morgenmensch, aber das gerade ist selbst mir zu viel. Ständig fliegt die Tür des Aufenthaltsraumes auf und zu. Das fehlende Frühstück ergänzt das Ganze. Mein Kreislauf sackt in den Keller. Ich sehe wohl aus wie eine Wand, denn blitzschnell ist meine Schwester zur Stelle.
Ich bin wohl doch nicht so belastbar, wie ich dachte.
Doch damit bin ich kein Einzelfall, sondern ein Paradebeispiel der Generation Z. Laut einer von der Unternehmensberatung McKinsey in Auftrag gegebenen Studie gibt jeder vierte Befragte der Generation Z an, sich emotional stärker belastet zu fühlen. Der Generationenforscher Rüdiger Maas schließt sich dem an: „Bei der Generation Z lässt sich ein Anstieg an psychischen Störungen beobachten. Zudem wird Stress sehr schnell negativ interpretiert, wodurch weniger Resilienz vorhanden ist.“
Die große Wanduhr im Aufenthaltsraum zeigt sieben Uhr. Meine Schwester und ihre Kollegin sitzen entspannt an einem großen Tisch, der Duft von Kaffee schwebt in der Luft. Wann wohl der erste Einsatz kommt? Ob es etwas Schlimmes sein wird? Meine Nervosität könnte aktuell wohl ein ganzes Wohngebiet mit Strom versorgen. Zusätzlich muss ich auch auf die Toilette. Weit komme ich jedoch nicht, denn plötzlich bimmelt und vibriert es an meinem Gürtel. Mein erster Einsatz! Ich mache kehrt und begegne auf dem Weg zum Rettungswagen meiner Schwester. Ich werfe ihr einen verzweifelten Blick zu: „Ich bin überfordert“, rufe ich und hantiere mit dem Melder, der nicht aufhören will, lautstark zu piepsen. Beim Blick auf das Display wird mir ganz anders zumute: „Schlägerei Erwachsener. Eigenschutz beachten.“ Eine Adrenalinwelle durchflutet meinen Körper, als ich auf den Beifahrersitz des Rettungswagens klettere, dieser sich rasant in Bewegung setzt und die Straße an mir vorbeifliegt.
Am Einsatzort herrscht eine bedrohliche Atmosphäre. Der Verletzte lehnt an einem grünen Tor einer Lagerhalle, daneben stehen vier lachende Männer. Mein Puls rast, als wir zum Verletzten eilen. Schnell wird er in den Rettungswagen gebracht. Ich bleibe jedoch wie ein Reh im Scheinwerferlicht bei den Männern stehen. Plötzlich steht Sophia neben mir, zieht mich zur Seite und in den Rettungswagen.
Um 8.56 Uhr zeigt der Melder bereits den nächsten medizinischen Notfall an. Schnell steige ich in den hinteren Bereich des Rettungswagens und setze mich auf den blauen Sitz, mit dem Rücken zum Fahrer. Während wir der Atemnot entgegenrasen, das Gefährt aufgrund der Geschwindigkeit lautstark wackelt, das Martinshorn ohrenbetäubend ertönt, zieht mein Leben wie ein Film an mir vorbei. Alles um mich herum wirkt plötzlich so unbedeutend – hier geht es um ein Menschenleben. Ich werfe einen nervösen Blick auf den Melder, dann auf meine Armbanduhr. Panik steigt in mir auf: Wir sind schon zehn Minuten unterwegs! Ob die Person mit der Atemnot noch lebt? Die Fahrt bringt mich zum Nachdenken über die außergewöhnliche Belastung, die Notfallsanitäter täglich bewältigen müssen. „Das Anforderungsspektrum eines Notfallsanitäters kann nicht jeder Mensch erfüllen. Der Umgang mit Älterwerden, Krankheiten mit nachfolgendem Tod, Sterben und anschließenden Trauerprozessen werden in der gegenwärtigen Gesellschaft eher geleugnet beziehungsweise verharmlost“, so Dr. Jörg Schablewski, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Plötzlich kommt der Rettungswagen zum Stehen. Ich schiebe reflexartig die Tür auf und erkenne, dass es sich um eine Schule handelt. Am Schultor steht eine aufgeregt winkende Schülerin. Schnellen Schrittes folge ich meiner Schwester und ihrer Kollegin. Die Patientin sitzt gekrümmt, kreidebleich und mit verkrampften Fingern auf einer Mauer. Sie atmet panisch. Mithilfe neurologischer Tests prüft Sophia den medizinischen Zustand der kritischen Patientin. Beruhigend spricht sie auf die junge Frau ein, die nicht aufhören kann zu weinen und dabei sehr schnell zu atmen. Ich frage mich derweil, wie man diese Belastung und den enormen Stress tagtäglich durchstehen kann, ohne psychisch zugrunde zu gehen. „Beim Umgang mit stressigen Situationen wie im Rettungsdienst, helfen soziale Beziehungen oder sportliche Betätigung. Jedoch lernt man erst durch die mehrmalige Erfahrung mit den herausfordernden Situationen umzugehen“, so Schablewksi.
Wir betreten eine zugestellte Wohnung, an den Wänden hängen unzählige Erinnerungen. Ein älterer Herr liegt verkehrt herum und leicht verrenkt auf dem Boden, entblößt, ohne Unterhose. Ich bin überrumpelt. Meine Schwester lässt das kalt, sie führt eine Anamnese durch und stellt fest: Der ältere Herr muss schleunigst ins Krankenhaus.
Doch der ältere Herr verhält sich bockig wie ein kleines Kind: „Ich will zuhause sterben.“ Sophias Kollegin dreht sich zu mir: „Wenn jemand sich weigert, lieber krank bleiben will und sterben möchte, müssen wir das akzeptieren.“ Mir schießen sofort die Tränen in die Augen. Der Satz trifft mich tief. Die nächsten Minuten stehe ich irgendwie durch. Meiner Schwester gelingt es, ihn mit großer Überredungskunst dazu zu bewegen, ins Krankenhaus mitzukommen. Um 13.30 Uhr ist meine Schicht dann geschafft, und ich bin es auch.
Als wir aus der Tür der Wache laufen, scheint mir die Sonne direkt ins Gesicht. Ich kneife die Augen zu und gehe zum Auto, das auf dem Parkplatz steht. Als ich mich hinsetze, merke ich, wie erschöpft ich bin. Meine Schwester verbindet ihr Handy mit dem Auto. „Party-Playlist“ erscheint auf dem Display und plötzlich ertönt ein Hardstyle-Song aus den Lautsprechern. Das ist gerade das Gegenteil meiner Stimmung. Die Bilder der heutigen Einsätze lassen mich nicht los und ploppen immer wieder wie kleine Wasserbälle an der Oberfläche des Sees meiner Erinnerungen auf.
Auch an den darauffolgenden Tagen wollen die Bilder nicht verschwinden. Immer wieder tauchen kleine Erinnerungsfetzen auf: der alte Herr am Boden, die rasante Fahrt. Mein Selbstversuch hat mir gezeigt, dass ich als Vertreterin der Generation Z psychisch weniger belastbar bin als gedacht. Als wir eines Abends gemeinsam auf dem Balkon sitzen, sagt Sophia zu mir: „Es geht nicht darum, keine Schwächen zu haben, sondern Strategien zu entwickeln, um resilienter zu werden.“ Das stimmt mich nachdenklich. Ist unsere Sensibilität möglicherweise eine Stärke, die wir erst noch entdecken müssen?
Alle Bilder und Videos wurden von der Autorin selbst aufgenommen.