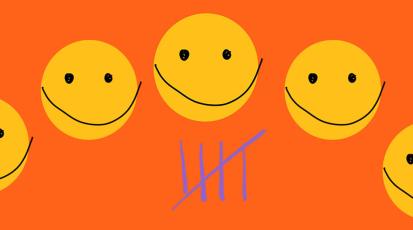Aufgeben is' nich'!
Meine noch zugekniffenen Augen scannen den Handy-Bildschirm. Eine Push-Benachrichtigung der tagesschau-App blitzt auf: „Russland hat den Krieg begonnen“. Scheiße, das kann doch nicht sein. In mir breitet sich ein beklemmendes Gefühl aus, mein Herz schlägt schneller. Noch halb verschlafen überfliege ich den Artikel, schüttele innerlich immer wieder den Kopf, keine zwei Minuten später bin ich hellwach. Von 0 auf 100 — aus der sanften Traumwelt gerissen und in die grausame Realität hineinkatapultiert. Fassungslos. Sprachlos. Ahnungslos, wie es weitergehen soll.
In solchen Momenten will ich aufgeben. Schwach sein dürfen. Mich ganz klein machen, zusammenrollen, alles hinschmeißen und sämtliche Pflichten und Erwartungen vergraben. Das leidige Gefühl stoppen, funktionieren zu müssen. Doch die Welt dreht sich immer weiter. Bei dem Gedanken an einen dritten Weltkrieg geht es mir schlecht und dennoch laufe ich wie gewohnt zur Arbeit, muss so tun, als ob nichts wäre. Die Gesellschaft zeigt mir zu oft, dass es nicht okay ist, zu verzweifeln.
Aufgeben war keine Option
Die Geschichte unserer Menschheit ist gezeichnet von gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Krisen. Es hat sie schon immer gegeben, es wird sie immer geben. Krisen werden als eine überraschend auftretende Situation definiert, deren Verlauf und Ausgang unvorhersehbar ist. Aktuell erleben wir hautnah, wie es ist, mit und in einer Krise zu leben. Wir schwanken fast täglich zwischen Hoffnung und Zorn; akzeptieren schwermütig, dass es nur langsam oder gar nicht vorangeht. „In den 20er-Jahren stehen wir vor mindestens sieben fundamentalen, teils epochalen Veränderungen. Man könnte also sagen: ein bisschen viel auf einmal“, schreibt Bernd Ulrich in seinem ZEIT Online Artikel „Das Jahr, in dem die Normalität zu Ende ging“ über die Corona-Pandemie.
Der alten Generation wurde bereits durch Kriege, Armut und Angst enorm viel Durchhaltevermögen abverlangt. Diese Werte wurden durch den damaligen strengen Erziehungsstil bewusst verinnerlicht und weitergegeben. So galten Pflichtbewusstsein und (falscher) Ehrgeiz als Tugenden, während Aufgeben ein Zeichen von Schwäche war. Aussagen wie die von meiner Oma, dass die jungen Leute sich nur „anstellen” würden – völlig normal. Kraftlos und erschöpft war sie sicher auch oft, aber aufgeben? Daran hatte sie selbst in den ärmsten Zeiten nie einen ernsthaften Gedanken verschwendet.
In unserer Generation hat sich dahingehend einiges verändert in den letzten Jahren. Wir lernen aus den Fehlern unserer Familie, werden zunehmend toleranter, versuchen gesellschaftliche Probleme schneller zu erkennen, benennen und zu handeln. Wenn das Studium keinen Spaß macht, wird es abgebrochen; wenn jene*r Partner*in nicht mehr gefällt, wird er oder sie verlassen. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben, wollen möglichst viel daraus machen, manchmal zu viel. Was stört, soll sofort geändert werden, denn wir allein sind ja für unser Glück verantwortlich. Dadurch entsteht der Druck, funktionieren zu müssen, auch wenn die eigene Situation es nicht immer zulässt.
Wenn der Stress uns stresst
Schlechte Nachrichten werden beim Menschen grundsätzlich als eine Bedrohung unserer Umwelt wahrgenommen — diese Gefahr ist ein Kernfaktor für Stress. Toxischer Stress entsteht dann, wenn es keine Antwort gibt auf die Frage: Wie sichere ich mein körperliches, mentales und soziales Wohlbefinden? Das Gehirn befindet sich dann in einer Art „Turbomodus“ und sucht Tag und Nacht nach einer Lösung für das Problem, erklärt Hirnforscher und Professor der Universität Lübeck, Achim Peters, in einem Interview mit dem rbb. Ein längerfristig erhöhtes Stresslevel führt zwangsweise zu einem Gefühl von Erschöpfung. Das kann sich durch schlaflose Nächte, sozialen Rückzug und im schlimmsten Fall in einer Depression bemerkbar machen.
„Ich bin ausgebrannt“, schreibt mir neulich eine gute Freundin. Ich kenne das Gefühl und es überrascht mich leider nicht. Seit über zwei Jahren verlangt die Pandemie viel von uns ab. Stabilität und Sicherheit gab es wenig. Motivation wird mit Resignation getauscht, der Gedanke „Wofür das alles?“ wird zu einem großen, pochenden Schmerz in meiner linken Brust. Die Energiereserven scheinen alle aufgebraucht und während man sich mit den letzten Kräften gerade so durch die Prüfungszeit hangelt, steht plötzlich die Gefahr eines dritten Weltkriegs im Raum. Zu allem Übel gibt es dazwischen noch die eigenen, ganz persönlichen Krisen.
Ein Moment voller Hoffnung
November 2021. Um mich herum hüpfen hunderte Menschen in die Luft; toben, grölen, schreien diese Worte lauter als jemals zuvor. „Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut!“ Meine Stimme bebt, meine Stimmung steigt mit jedem Atemzug. Bunte, flackernde Lichter blenden mich, der Bass dröhnt in meinen Ohren. Ein beißender Geruch von tanzenden, schwitzenden Körpern schleicht sich in meine Nase, aber es stört mich nicht. Ich unterdrücke ein vermeintlich aufsteigendes Ekelgefühl mit glänzenden Augen — endlich wieder. Ein Konzert. Mehr als ein Konzert — Leben! Was hatte ich mich darauf gefreut und bis zuletzt gezittert, ob es stattfinden würde.
Da stand ich also, vollgepackt mit positiven Emotionen, und trällerte zusammen mit meinen Freund*innen, Felix Kummer und vielen fremden Menschen ein „ALLES WIRD GUUUUT“ in die Welt. Und das ohne Maske. In dem Moment fühlte ich: Bald wird die Pandemie ein Ende haben. Bald werden wir uns wieder alle unbeschwert in den Armen liegen, und all das nachholen, was wir die letzten zwei Jahre verpasst haben. Dann kommt plötzlich alles anders — spätestens seit letzter Woche frage ich mich: Wenn alles gut werden soll, wann wird es überhaupt erstmal besser?
Umgang mit Krisen
Auch wenn wir dachten, das Schlimmste sei vorbei; auf uns kommen höchstwahrscheinlich noch härtere Zeiten zu. Europas Frieden ist bedroht und rückt damit die Pandemie sichtlich in den Hintergrund. Hilflosigkeit, Angst, Frustration und Wut — die uns bekannten Begleiter der letzten Jahre werden nicht verschwinden. Im Gegenteil. All diese Gefühle wollen bewusst gefühlt werden. Sie zeigen uns, dass wir noch nicht abgestumpft sind und wie menschlich wir doch sind. Unsere Kraft liegt allerdings darin, die Intensität und Dauer unserer Emotionen selbst regulieren zu können. Und dabei ist vollkommen okay, wenn wir uns überfordert fühlen, aufgeben wollen und Dinge nicht schaffen. Weil wir in einer Krise stecken. In der nächsten.