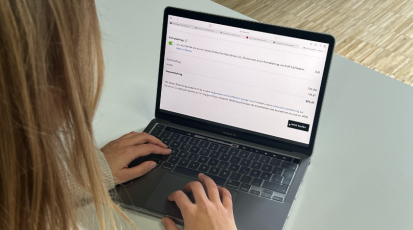„Durch die Klimakrise entsteht ein hoher Transformationsdruck.“
Klimawut in der Klimanot

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema „Klimapsychologie: Kognitive Dissonanz zwischen Wissen und Handeln“.
Außerdem zum Dossier gehören folgende Beiträge:
- Kommentar: Klima darf kein Nebenfach bleiben
- Podcast: Wie kann man Menschen wieder zusammenbringen?
Familienfeier inmitten einer Klimakrise. Onkel Hans regt sich lautstark über die völlig übertriebenen Klimaschutzmaßnahmen auf. E-Autos, gestiegene Diesel-Preise und Verbote überall. Während er sein zweites Würstchen genießt, sitzt seine Nichte Maria da und kocht innerlich vor Wut. Sie denkt: „Warum sieht er nicht, dass zu wenig getan wird, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen?“
Kommt dir das bekannt vor? Wie Onkel Hans und Maria geht es vielen. Die Klimakrise beunruhigt.
Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2023 schätzen 93 Prozent der Europäer*innen den Klimawandel als ernstes Problem ein. Doch warum herrschen unterschiedliche Meinungen, obwohl die Mehrheit der Befragten den Klimawandel als ernstes Problem wahrnimmt?
Zwei Seiten der Klimawut
Lea Dohm, Psychologin und Mitgründerin von „Psychologists for Future“, erklärt: „Durch die Klimakrise entsteht ein hoher Transformationsdruck. Es muss sich in der Gesellschaft innerhalb kurzer Zeit viel ändern, um die Krise in den Griff zu bekommen.“ Das betreffe alle Menschen, jedoch in unterschiedlichem Maße. Besonders aber diejenigen, die direkt davon benachteiligt werden. Beispielsweise, wenn sie dadurch den Arbeitsplatz wechseln müssen oder aufgrund körperlicherer oder psychischer Erkrankungen keine Kapazitäten haben, sich zusätzlich noch mit diesem Thema zu beschäftigen. Viele mache das Klima dementsprechend wütend oder ängstige sie.
In den letzten Jahren taucht der Begriff „Klimawut“ vermehrt in den Medien auf. Psychologin und Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk beschreibt Wut in ihrem Artikel wie folgt: „Wut ist das Gefühl, das wir fühlen, wenn etwas ungerecht ist oder jemand eine Grenze bei uns überschreitet.“ Klimawut sei folglich der Zorn darüber, dass die Gerechtigkeit in der Klimakrise stark aus dem Gleichgewicht geraten sei. Dies betreffe insbesondere die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, zwischen älteren und jüngeren Generationen, sowie zwischen dem Globalen Norden und Süden.
Dohm erklärt: „Klimawut kann, vereinfacht gesehen, in zwei Richtungen gehen.“ Einerseits könne sich die Wut, wie bei Onkel Hans, gegen diejenigen richten, die sich stark für den Klimaschutz engagieren, wie Aktivist*innen und Politiker*innen. Denn laut Dohm führen die Maßnahmen zum Klimaschutz dazu, dass sich diese Gruppe von Menschen oft in ihrem Alltag und ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt
fühlt, beispielsweise durch Debatten über ein Tempolimit. Andererseits könne sich die Wut, wie bei Nichte Maria, häufig gegen die Verursacher der Klimakrise richten. Dazu gehörten Superreiche mit Privatjets und die fossile Industrie, die für hohe Emissionen verantwortlich sind.
Dohm ist sich sicher: „Beide Wutgruppen empfinden Zorn, weil sie das Gefühl haben, dass in Bezug auf ihre Bedürfnisse im Klimaschutz entweder zu wenig getan oder nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.“ Die Wut der Menschen könne zu einem Gefühl von Frust oder Ohnmacht führen. Besonders, wenn sie sich in ihren Bedürfnissen nicht gesehen fühlen. Sie glauben, sie hätten nur wenig Einfluss auf die Entwicklung der Klimakrise und die damit ergriffenen Maßnahmen. „Dieses Gefühl der Machtlosigkeit verstärkt ihre Frustration und lässt sie an der Wirksamkeit ihrer eigenen Bemühungen zweifeln“, merkt Dohm an. Laut Eurobarometer-Umfrage gaben 76 Prozent der Deutschen an, in den letzten sechs Monaten persönlich etwas zur Bekämpfung des Klimawandels beigetragen zu haben. Trotz des Engagements scheint es schwer, einige Klimaziele, wie die Begrenzung der Erderwärmung, einzuhalten. Dies zeigt auch der Copernicus-Bericht.
Die Psychologie hinter der Klimawut
Laut Copernicus-Bericht war 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1850. Erstmals überschritt die globale Durchschnittstemperatur die 1,5-Grad-Marke über dem vorindustriellen Niveau. Rekorde bei Treibhausgasen, Luft- und Meerestemperaturen führten zu extremen Wetterereignissen, wie das Hochwasser im Ahrtal und die vor Kurzem wütenden Waldbrände in Los Angeles. Obwohl die Menschen wissen, dass der Klimawandel real ist und Maßnahmen erforderlich sind, handeln sie häufig nicht klimaneutral. Ein Beispiel dafür ist der ökologische Fußabdruck. Der ökologische Fußabdruck eines jeden Menschen sei laut Bundesumweltministerium (BMUV) noch zu groß. Das Ziel ist, den CO2-Ausstoß pro Person auf unter eine Tonne CO2e zu reduzieren. Derzeit liegt der jährliche CO2-Ausstoß eines durchschnittlichen Deutschen jedoch bei etwa dem Zehnfachen. Warum stimmt das eigene Verhalten nicht mit den eigenen Überzeugungen überein?
Dohm ist sich sicher, dieses Verhalten entstehe unter anderem durch kognitive Dissonanz. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der es kaum möglich ist, klimaneutral zu leben, ohne sich stark abzugrenzen“, sagt sie. Besonders Menschen, die durch die Klimaschutzmaßnahmen verärgert sind, neigen dazu, das Thema zu meiden. Sie ignorieren Klimaberichte oder weigern sich, sich weiter damit zu beschäftigen. Auf diese Weise versuchen sie, unangenehme Gefühle wie Schuld oder Unwohlsein kurzfristig zu vermeiden, weil sie wissen, dass sie selbst zu wenig dagegen unternehmen.
Kognitive Dissonanz beschreibt, was passiert, wenn unsere Gedanken (Kognitionen) oder unser Verhalten im Widerspruch zueinander stehen. Dieses Ungleichgewicht erzeugt ein unangenehmes Spannungsgefühl, das Menschen auflösen wollen. Die Auflösung kann durch die Änderung ihrer Einstellung oder Überzeugung erfolgen. Ein Beispiel für kognitive Dissonanz ist das Wissen über die klimaschädlichen Auswirkungen von Flugreisen. Trotzdem fliegen viele in den Urlaub, weil sie Bequemlichkeit und Lebensfreude über die Sorge um das Klima stellen.
Quelle: Dorsch – Lexikon der Psychologie
Auch bei der Gruppe, die wütend ist, weil in ihren Augen zu wenig für den Klimaschutz gemacht wird, könne man laut Dohm eine Form von kognitiver Dissonanz feststellen: „Wenn sich Menschen intensiv mit den Gefahren des Klimawandels auseinandersetzen, können starke Gefühle, wie Angst oder Dringlichkeit, entstehen. Doch wenn sie erleben, dass ihr Umfeld das Thema ignoriert, führe das oft zu Entfremdung und Frustration.“ Eine häufige Folge sei auch die Verdrängung des Themas, weil man doch noch dazugehören wolle.
Demzufolge beeinflussen nicht nur das Wissen, dass wir etwas tun sollten, unsere Entscheidungen, sondern auch unser Umfeld. Gruppen, in denen wir uns aufhalten, beeinflussen uns stark. Die Helmut-Schmidt-Universität beschreibt das psychologische Phänomen „Gruppendenken“ wie folgt: „Gruppendenken, auch bekannt als „Group Think“, beschreibt das Phänomen, bei dem bei Gruppenentscheidungen der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe wichtiger erscheint als die Beachtung realer Fakten.“ Wenn man sich in einer Gruppe aufhält, die sich darüber aufregt, dass die Klimamaßnahmen ihre persönliche Freiheit einschränke, nehme man oft unkritisch die Meinung dieser Gruppe an. Die Wut im Zusammenhang mit der Klimakrise werde folglich befeuert. Oftmals werden Entscheidungen in diesem Zusammenhang auch nicht hinterfragt, um Konflikte zu vermeiden und die Gruppeneinheit zu wahren. Gruppendenken könne überall auftreten, doch vermehrt in größeren Gruppenkonstellationen, wie zum Beispiel in der Schule.
Auch interessant
Macht Hitze aggressiv?
Klimawut steigere sich demnach in Gruppenkonstellationen. Doch es gibt auch noch einen weiteren Faktor, der den Zorn um das Klima befeuert: Hitze. Aggressionsforscher Craig Anderson stellte im Jahr 2001 fest, dass mit zunehmender Temperatur das Verhalten zunehmend aggressiver werde. Einen Anstieg der Gewalt im Zusammenhang mit höheren Durchschnittstemperaturen ist denkbar: Die Hitze beeinflusse unsere Erregbarkeit und Reizbarkeit, was dazu führe, dass wir weniger aufmerksam sind und unsere Selbstregulation nachlässt. Infolgedessen könnten negative und feindselige Gedanken zunehmen. Zudem könnte die Hitze unsere kognitiven Funktionen wie Lernen, Denken und Problemlösen beeinträchtigen, was es schwieriger machen würde, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die steigenden Temperaturen des Klimawandels könnten demnach auch die Klimawut verstärken. Denn Hitze könnte nicht nur unser Verhalten beeinflussen, sondern auch zu mehr Aggression und Gewalt führen. Dies könnte die Herausforderungen im Umgang mit der Klimakrise zusätzlich verschärfen, da die Menschen weniger einsichtig seien.
Laut Geo-Magazin ist es wichtig, über belastende Themen zu sprechen, da aufgestaute Wut und andere Emotionen die Gesundheit belasten können. Der Klimawandel und seine Folgen stellen für viele Menschen eine große psychische Belastung dar. Das Ahrtal-Hochwasser 2021 verdeutlicht, welchen Einfluss Umweltkatastrophen auf die Gesundheit haben. Daten des BKK-Landesverbands Nordwest zeigen, dass sich die Folgen des Hochwassers stark auf die Gesundheit der Bevölkerung vor Ort ausgewirkt hat. Depressive Episoden sowie Belastungs- und Anpassungsstörungen nahmen dort zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021 zu. Offen über Ängste und Wut zu sprechen, könnte ein Weg sein, um mit den psychischen Belastungen der Klimakrise besser umzugehen.
Gefühle können folglich durch äußere Einflüsse, wie Gruppenkonstellationen oder auch Hitze verstärkt werden. Viele Menschen rechtfertigen ihr Handeln und ihre Gefühle unterbewusst durch eine Form von kognitiver Dissonanz. Jedoch weisen uns Gefühle darauf hin, dass etwas wichtig ist. Aus diesem Grund seien auch negativ behaftete Emotionen, wie Wut und Ärger, laut Dohm weiterführend: „Das Ziel soll nicht sein, Wut wegzubekommen, sondern sie in einem Rahmen zu halten, damit man trotzdem das Gefühl hat, man kann noch gut damit umgehen.“