„Am Morgen nach Assads Sturz bin ich aufgestanden, habe laut Musik angemacht und getanzt.“
Eiad kam 2015 über den Libanon und die Balkanroute nach Deutschland. Ich lernte ihn kennen, als ich 12 Jahre alt war, und er war oft bei uns zu Hause. Mein spärliches Wissen über Syriens Diktator Assad und den Bürgerkrieg hatte ich von der Kinderfernsehsendung „logo!“, die versuchte, Kindern die Vielzahl der politischen und paramilitärischen Akteure zu vermitteln. Damals verortete ich Syrien etwa dort, wo eigentlich Libyen liegt und so war es Eiad, der seitdem mein Bild von Syrien geprägt hat. Wie viele andere hatte ich in den letzten Jahren die Hoffnung aufgegeben, dass Syriens Diktatur enden würde. Aber genau das geschah im Dezember 2024. Ich schrieb Eiad, weil ich wissen wollte, was er fühlte.
Wenige Wochen später besuche ich Eiad und seine Familie in Frankfurt. Seit ich ihn im Sommer das letzte Mal gesehen habe, haben sich erste silberne Strähnen in sein dunkles Haar geschlichen. Er kocht uns Nudeln mit Tomatensoße, während ich auf dem weißen Kinderstuhl seiner Tochter Amaya sitze und mich an früher erinnere.
Wenn Eiad am Esstisch mit meinen Eltern über Assad, den IS und den Bürgerkrieg sprach, verstand ich meistens nicht viel. Was ich allerdings verstand, war, dass er keinen Smalltalk mag und dass er viel über Geschichte und Mythologie weiß. Irgendwann drehten sich die Gespräche um sein Studium und seine Gitarre, dann um seine Freundin Julia und schließlich um seine kleine Tochter Amaya. Für mich geriet seine Fluchtgeschichte in Vergessenheit. Ich habe mich immer gefragt, ob er das weiß.
Was blieb, war das syrische Essen, das er oft für uns kochte, seine Zigaretten und sein Matetee.
Eine Bekannte meiner Eltern, die sie auf einer Reise durch Syrien vor dem Bürgerkrieg kennengelernt hatten, bat sie darum, Kontakt mit Eiad aufzunehmen. Er war nicht wie viele der anderen Bekannten, die meine Eltern zum Essen einluden. Er war Anfang 20 – großer-bruder-jung.
Es war Eiad, der mir gezeigt hatte, wie man eine Zigarette dreht. Ich war glücklich, als wir im Flur auf dem Boden knieten, denn vor meinen Mitschüler*innen hatte ich nicht zugeben wollen, dass ich es noch nie gemacht hatte. Geraucht habe ich die krumme Zigarette nicht. Ich glaube auch nicht, dass Eiad es mir erlaubt hätte – ich war 13. Heute sagt er, dass er danach ein schlechtes Gewissen hatte.
Krieg und Zerstörung: Was Kinderohren alles nicht verstehen
Mit Amaya an der Hand gehen wir in ihrem Frankfurter Stadtviertel spazieren. Seine Nachricht vom 8. Dezember hat etwas in mir wachgerüttelt, und ich möchte endlich mehr über seine Vergangenheit und seine Gedanken zur aktuellen Lage in Syrien erfahren.
Ich frage Eiad, ob er Assads Sturz hat kommen sehen. „Obwohl ich schon Nächte vorher davon geträumt habe, konnte ich es kaum fassen. Ich bin morgens aufgestanden und habe laut Musik angemacht und getanzt. Gemeinsam mit Amaya habe ich diesen Diktator beschimpft“, sagt er. Wenn Eiad lacht, zieht er dabei leicht die Schultern hoch, was ihn trotz seines schelmischen Blicks fast ein bisschen schüchtern wirken lässt.
Seit sich unter HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa eine Übergangsregierung gebildet hat, gibt es Hoffnung auf ein neues Syrien. Trotzdem hätten viele erst Angst vor den Rebellentruppen gehabt. Sie hätten geglaubt, dass Baschar al-Assad das Beste für Syrien, oder zumindest das kleinere Übel sei, erzählt mir Eiad.
„Hast du auch mal daran geglaubt?“, frage ich. „Auf keinen Fall!“, antwortet er. Assads Propagandamaschine habe aber bei vielen gewirkt, auch in Eiads eigener Familie. Er könne das verstehen, sagt er, schließlich sei die friedliche Revolution damals von terroristischen Gruppen „geschluckt“ worden und der IS hätte Angst verbreitet. „Das war eine sehr dunkle Zeit“, erinnert er sich.
Die HTS ist ein Bündnis islamistischer Milizen, das maßgeblich zum Sturz des Machthabers Baschar al-Assad beigetragen hat. Bis 2016 gehörte die HTS der al-Nusra-Front an. Diese wiederum war ein Zweig des Terror-Netzwerks al-Qaida. Bis heute wird die HTS von der EU als Terrororganisation eingestuft. Anführer Ahmed al-Scharaa gibt sich seit einigen Jahren gemäßigt. Unter seiner Führung hat sich jetzt eine Übergangsregierung in Syrien gebildet, die angekündigt hat, eine neue Verfassung ausarbeiten zu wollen. Die Abkürzung HTS steht für „Hajat Tahrir al-Scham“, übersetzt „Organisation zur Befreiung Syriens“.
Quelle: Auswärtiges Amt
Ich habe viele Fragen und Eiad hat viel zu erzählen, also drehen wir eine weitere Runde durch das Stadtviertel und den angrenzenden Park. Während wir spazierengehen, will Amaya die meiste Zeit getragen werden. Sie ist still geworden. Mit der Kleinen auf dem Arm reden wir über Zerstörung und Folter, über das Gefängnis Sednaja und Eiads Brüder, die desertiert sind.
Abends, als Amaya schläft, sitze ich mit Julia auf dem Sofa. Wir essen Baklava und Halawet, eine Nachspeise aus süßem Käse und Gries. Julia ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und streicht immer wieder leicht über ihren Bauch. Je später am Tag, desto lieber philosophiert Eiad. Über Fragen der Menschheit, menschliche Beziehungen und den altpersischen Philosophen Rumi. Nicht selten schweift er dabei ab. Das war schon immer so. „Wisst ihr, eigentlich ist das Gefühl von Nähe viel wichtiger als Romantik in einer Beziehung. Diese Nähe hält einen zusammen“, sagt er. „Keiner weiß, wie lange ich es noch mit Julia aushalten muss.“ Er lacht. Dafür kassiert er einen liebevollen Tritt gegen sein Bein.
Eiad wohnte nach seiner Ankunft in Deutschland in einer kleinen Stadt südlich von Frankfurt und war dort Musterbeispiel für gelungene Integration geworden: intelligent, sprachbegabt, wissbegierig und anpassungsfähig. Ich glaubte damals daran, dass Eiad eines Tages nach Syrien zurückkehren und eine wichtige Rolle im Wiederaufbau spielen würde. Dass er ein wichtiger Politiker, wenn nicht sogar Präsident, werden würde. Daran, dass er dann nicht mehr hier wäre und wir nicht mehr gemeinsam Nudeln mit Tomatensoße oder Baklava essen würden – daran hatte ich nicht gedacht.
Kehrt Eiad jetzt zurück?
Einige Syrer*innen, die inzwischen in Deutschland leben, sind seit Dezember schon nach Syrien gereist, um Familie wiederzusehen und sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Es war auch mein erster Gedanke, ob Eiad sich das wünscht. „Ich habe die Hoffnung, dass ich endlich meine acht Geschwister wiedersehen kann“, sagt Eiad. Julia kann sich das auch vorstellen, zumindest für einige Wochen. Aber nicht in der gegenwärtigen Situation, in der alles noch so unsicher und die politische Lage so instabil ist. In einigen Regionen finden auch immer noch Kämpfe statt. „Ich möchte Julia auch gar nicht in die Lage bringen, in der sie sich nicht sicher fühlt. In der sie Angst um ihre Kinder hat, die ja auch meine Kinder sind.“ Eiad redet mit einer ruhigen, leisen Stimme.
„Syrien ist noch nicht so weit, es ein Land in Schutt und Staub“, erklärt mir Eiad. Es habe ja auch Jahre gedauert, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufzubauen. Deutschland wäre nicht einfach wiederhergestellt gewesen, nachdem Hitler weg war. Das könne man auch auf Syrien beziehen. „Es wird Jahre dauern, bis es wieder politisch stabil ist, bis eine Infrastruktur und das Gesundheitssystem wiederhergestellt sind. Und trotzdem wird von Deutschen jetzt gefordert, dass wir alle so schnell zurückgehen sollen?“
Migrationsforscherin Nora Ragab betont, dass eine Rückkehr nur freiwillig erfolgen sollte. Dafür müsse sich zunächst eine stabile Regierung etablieren – idealerweise durch Wahlen, an denen auch im Ausland lebende Syrer*innen teilnehmen können. Eiad, der eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, könnte den Wiederaufbau so auch politisch unterstützen. „Es ist wichtig, dass sich ehemals Geflüchtete weiter zugehörig fühlen können und ihnen eine Mitbestimmung ermöglicht wird“, so Ragab. Bis dahin sei es noch ein langer Weg.
Ob ein Besuch in Syrien möglich ist, hängt von der Art des Schutzstatus ab. Syrischen Menschen, die nach ihrer Flucht zum Beispiel nur ein Abschiebeverbot oder den subsidiären Schutz erhalten haben, kann dieser Schutz aberkannt werden, sobald sie in ihr Herkunftsland zurückreisen. Das bedeutet: Vielen geflohenen Syrerinnen und Syrern, ist es nicht möglich, sich die Lage vor Ort anzusehen, bevor sie eine endgültige Entscheidung über eine Rückkehr treffen.
Quelle: BAMF
Während seiner Flucht musste Eiad immer wieder von vorne anfangen, an fremden Orten. In Deutschland ein ganz neues Leben. Obwohl er Archäologie in Aleppo und Wirtschaftsgeografie in Frankfurt im Master studiert hat, findet er gerade keinen anderen Job als seine momentane Arbeit im Reisebüro. Das macht ihm sehr zu schaffen. Aber die Vorstellung, nochmal irgendwo neu anzufangen auch.
„Wie oft soll ich denn noch bei null anfangen?“, fragt Eiad. „Auch, wenn ich in Syrien geboren wurde, hat sich alles so sehr verändert, dass ich auch dort wieder bei null anfangen würde.“
Ragab bestätigt das, was ich bei Eiad beobachte: „Nur weil Menschen den Wunsch haben, eines Tages zurückzukehren, heißt das nicht, dass sie es tatsächlich tun werden. Rückkehrentscheidungen sind komplex. Neben der politischen Stabilität spielen wirtschaftliche Perspektiven, Infrastruktur und soziale Netzwerke eine entscheidende Rolle.“
Eiad zündet sich eine neue Zigarette an. „Aber weißt du – zum ersten Mal ist es eine echte Möglichkeit.“
Bleiben, anpassen?
In näherer Zukunft kommt eine Reise nach Syrien für die kleine Familie aber nicht infrage. Schließlich bekommen Julia und Eiad bald ihr zweites Kind.
Vor Amayas Geburt hatten sich meine Eltern und ich Sorgen gemacht, dass die kleine Tochter eines Tages in Deutschland wegen ihres Namens diskriminiert werden könnte. Jetzt, Jahre später, merke ich, dass dieser Gedanke Eiad wütend macht. „Sie ist Deutsche, egal wie sie heißt.“ Er sagt, wenn man sich immer anpasst, um bloß nicht diskriminiert zu werden, dann könne sich auch nichts ändern. Er beobachtet eine Spaltung in unserer Gesellschaft und dass immer mehr Menschen politisch rechte Einstellungen haben. Dass es bald nur noch ein „Wir“ gibt und ein „Sie“, dass man nicht mehr miteinander redet. Ob ihm das Angst macht?
„Ich habe schon einen Krieg überlebt. Wenn hier einer ausbricht – ehrlich, dann ist es mir egal, ob ich einen zweiten überlebe.“
„Das Thema betrifft alle. Wenn es wirklich zu diesen schlimmen Szenarien kommen sollte, dann wird es dich mehr betreffen als mich“, sagt er und schaut mich nachdenklich an. „Ich habe schon einen Krieg überlebt. Wenn hier einer ausbricht – ehrlich, dann ist es mir egal, ob ich einen zweiten überlebe.“
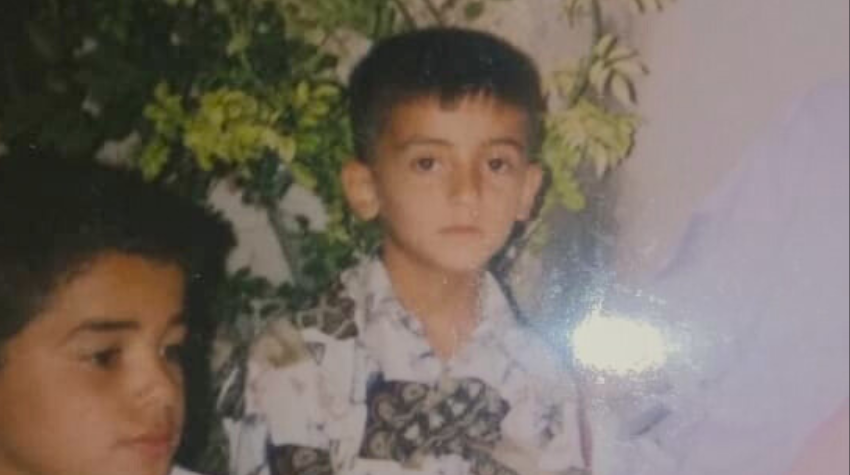
Nachdem er innerhalb Syriens schon mehrmals flüchten musste, floh Eiad in den Libanon. An Erzählungen von seinem Leben dort erinnere ich mich noch von früher. Von dort ging es weiter in die Türkei, mit einem Boot nach Griechenland und dann meist zu Fuß bis nach Ungarn. Ich habe nie nach den Details seiner Flucht gefragt. Nicht, als ich klein war, nicht als Teenager, nicht später. Jetzt traue ich mich.
„Ich und ein Freund waren ganz allein“, erzählt er. Nicht nur im Regen und im Schlamm, sondern auch auf dem Weg durch Sonnenblumenfelder, die uns vor der Polizei versteckten und uns gleichzeitig überallhin und nirgendwohin brachten.“
„Sonnenblumenfelder?“, frage ich nach.
Während er erzählt, stelle ich mir die blühenden Sonnenblumen tröstlich vor. Eiad schüttelt den Kopf. Es zeigt mir einmal mehr, dass ich keine Ahnung davon habe, was Flucht bedeutet.
Ich habe mich immer gefragt, ob Eiad bewusst war, wie viel (oder wie wenig) ich über seine Vergangenheit und seine Flucht wusste.
„Mir war klar, dass du nicht über alles Bescheid wissen kannst – du warst jung“, sagt er. Aber ich habe mich immer gefreut, dass du aktiv zugehört hast, wenn ich etwas erzählt habe. Nicht nur von meinen Erlebnissen im Krieg, sondern dass du dir die Perspektive von einer anderen Person angehört hast.“
Und ob er es schön gefunden hätte, wenn ich mehr zu seiner Fluchterfahrung gefragt hätte oder ob es richtig von mir war, es nicht zu tun?
„Im falschen Kontext hätte ich das wahrscheinlich als etwas unangenehm empfunden“, gesteht er. „Aber ich bin inzwischen ziemlich mit meiner Geschichte versöhnt. Ich mag es, sie weiterzuerzählen und mag es, danach gefragt werden, wenn der Moment passt. Es ist eine Geschichte, die gehört werden sollte, wie die von jedem Kriegsüberlebenden. Wir sind ein Zeitarchiv. Und Details zu unseren Geschichten erscheinen nur, wenn man nachfragt. Dadurch komme ich selbst auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen, die mir helfen, meine Geschichte zu verarbeiten.“
Noch immer ist es von außen schwierig, Syriens Umbruch zu beurteilen und bei den Rebellengruppen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Gut ist aber, dass Assad Syrien nicht mehr regiert.
Während meines Besuchs schaue ich mit Amaya das „Sandmännchen“. Irgendwann wird sie alt genug sein, um „logo!“ zu schauen. Ich sehe es vor mir, wie ihr Vater neben ihr sitzen und ihr die politischen Zusammenhänge und seine Vergangenheit erklären wird – so wie er es mir jetzt erklärt hat und besser, als es eine Fernsehsendung je könnte. Ich hoffe, dass sie sich traut nachzufragen und nehme mir fest vor, mich zu erinnern.





















