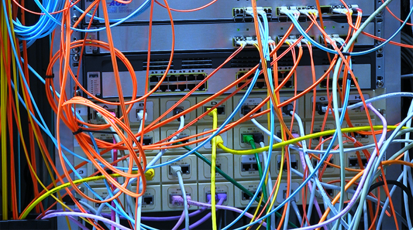Natürlich hat man psychischen Stress.
„Ich schaffe den Menschen eine neue Perspektive“

Wo das Leben endet, fängt seine Arbeit an: Folkmar Schiek ist Bestatter in Stuttgart-Vaihingen. Tod, Trauer und Abschied haben einen festen Platz im Alltag des 48-Jährigen. Locker und selbstverständlich spricht er über Themen, von denen andere Menschen so viel Abstand halten wie möglich. Trotzdem: Wenn er von aktuellen Sterbefällen erzählt, wählt er seine Worte sorgfältig aus, spricht langsam und macht Pausen. Denn er möchte nicht zu viel von den Angehörigen preisgeben. Zwar scheint er in seiner Arbeit richtig aufzugehen, trotzdem hat er offenbar einen innerlichen Abstand dazu aufgebaut. Denn bei geschäftlichen Themen spricht er oft von sich selbst als „man“.
Herr Schiek, als Bestatter gehört es zu Ihrem Alltag, Menschen in Trauer und Schockzuständen gegenüberzusitzen. Wie gelingt es Ihnen im Gespräch, auf die Bedürfnisse dieser Menschen einzugehen?
Vor kurzem waren bei einem Trauergespräch 15 Leute aus vier Generationen anwesend. Die Oma und ihre Enkelin waren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Da sollte man als Bestatter nicht im schwarzen Anzug kommen, denn die Menschen können nicht auch noch eine schwarze Front gebrauchen. Man geht also in Alltagskleidung dorthin und setzt sich zuerst zu den Kleinsten auf den Boden, spielt mit ihnen und mit dem Hund. Dann spricht man mit den Erwachsenen. Oft werden diese im Lauf des Gesprächs immer knöcherner und steifer, weil sie überfordert sind. In dem Fall sagt man: „So, jetzt steht ihr auf und bewegt euch und wir machen ein paar schriftliche Sachen“. Aufstehen, bewegen, rauchen, trinken, egal was. Und sofort sind sie aufgesprungen, ich hatte es noch nicht ausgesprochen. Man muss in solchen Situationen viel vorgeben und sicher sein, dass man das Gespräch führen kann. Auch über vier Stunden in dem Fall.
Was haben die Angehörigen im Gespräch gefragt?
Weil die beiden Verstorbenen durch den Unfall entsprechend verletzt waren, habe ich die Aufbahrung nicht mehr zugelassen. Deswegen hat mich der Mann der verstorbenen 81-Jährigen gefragt, wie seine Frau ausgesehen hat. Ich habe kein Problem mit harten Fragen, denn ich glaube, dass ich ein Mensch mit relativ wenigen Masken bin. Deswegen sage ich es so, wie es ist: Der Kopf ist durch den Aufprall eingedrückt, sie hat schwere Blutergüsse und innere Blutungen. Man sollte die Fragen so authentisch wie möglich beantworten, denn wenn es um das Abschiednehmen geht, werden Menschen ewig fragen, wie der Verstorbene ausgesehen hat. Die Mutter der verstorbenen jungen Frau wollte das auch über ihre Tochter wissen. Sie hatte ein Schädelhirntrauma, eine ganze Seite des Kopfes war komplett aufgeschwollen. Natürlich könnte man sagen: „Um Gottes Willen, seien Sie froh, dass Sie das nicht gesehen haben“. So könnte man zwar agieren, aber damit würde man relativ wenig Empathie zeigen. Besser ist es, wenn ich dem Angehörigen eine gedankliche Brücke baue. Ich habe also zu der Mutter gesagt: „Sie wissen, wie das ist, wenn ein hochallergischer Mensch von einer Biene gestochen wird. Dem schwellen sofort das ganze Gesicht und die Augen auf“. Sie wird das jetzt immer mit diesem Ereignis verbinden und das ist deutlich weniger dramatisch als wenn ich gesagt hätte, dass die Schwellungen von inneren Brüchen im Schädel kommen. Ich habe es ihr mit anderen Mitteln erklärt, die sie verstehen kann. Alles andere ist sinnlos. Oder sogar verantwortungslos.
Wie geht es Ihnen in solchen Situationen?
Wenn man die entsprechende Ausbildung und ein wenig Lebenserfahrung hat, hat man – und so geht es mir momentan – das entsprechende Handwerkszeug parat, mit solchen Situationen umzugehen. Man kann sie einordnen und vor allem machen sie einem selbst keinen Stress. Natürlich hat man psychischen Stress – es wäre schlimm, wenn man den nicht hätte. Aber es bringt einen nichts aus der Bahn – auch nicht, wenn die Leute am Tisch streiten. Bei Menschen in Überforderungssituationen ist das normal. Das darf sich nicht auf einen übertragen, man muss damit umgehen und es in das Gespräch mit einbeziehen.
Neben dem Beruf sind Sie als Künstler aktiv. Eine Art Motto von Ihnen lautet: „Kunst ist das kreative Schaffen von Neuem“. Haben Sie das Bedürfnis, in der Kunst Neues zu schaffen, weil Sie in Ihrem Beruf mit dem Gegenteil umgehen müssen?
Nein. Alles, was ich mache, hat etwas mit Neuschaffen zu tun. Auch in der Bestattung: Ich schaffe den Menschen eine neue Perspektive, neue Bilder, eine Vorwärtsentwicklung, mit der sie vorher nicht gerechnet hätten. Auch in der Kunst schafft man Neues, vor allem in der gegenstandslosen Malerei. Denn dabei habe ich eine weiße Leinwand vor mir, kein Motiv und vielleicht nur eine Farbidee. Aber wohin es sich entwickelt, weiß ich am Anfang noch nicht mal zu einem Promille. Deshalb ist das Ergebnis wirklich etwas ganz Neues. Dieses kreative Neuschaffen zieht sich durch all meine Berufe hindurch.
Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann war Folkmar Schiek im Verkauf, Vertrieb und Marketing tätig. Das darauffolgende Personalmanagement-Studium erlaubte ihm, stellvertretender Personalleiter und Assistent der Geschäftsleitung in einem mittelständischen Unternehmen zu werden. Als dort viele Stellen gestrichen wurden, stieg er als Praktikant in einem Bestattungshaus in Stuttgart-Vaihingen ein, in dem er fünf Jahre arbeitete. Neben dem Beruf absolvierte er eine zweijährige Ausbildung zum Familien- und Wirtschaftsmediator, bevor er sich im Mai 2010 als Bestatter, Mediator und Coach selbständig machte.
Im Juni 2018 wird die Stelle des Vaihinger Bezirksvorstehers frei. Sie sehen es als logische Konsequenz aus Ihrem beruflichen Werdegang, diesen Posten zu übernehmen. Wo sehen Sie die Verbindung zwischen dem Beruf des Bestatters und dem des Bezirksvorstehers?
Die wichtigste verbindende Klammer um all meine Berufe ist der Mensch. Für mich war es immer ein wichtiges Thema, mit Menschen umzugehen, ihnen zu helfen und in der Mediation auch stabilisierend zu wirken.
Derzeit sind Sie aber nicht nur Bestatter, sondern auch Hobby-Künstler und in Vereinen als Ehrenamtlicher tätig. Was müsste weichen, wenn Sie Bezirksvorsteher werden?
Weichen müsste definitiv mein Beruf, den ich an meinen Sohn übergeben würde. Das Ehrenamt würde ich behalten. Der Alltag als Bezirksvorsteher sähe natürlich etwas anders aus, wobei ich mir auch in dieser Position einräumen würde, meinen Tag zeitlich frei zu gestalten und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen. Ich glaube nämlich, dass es in diesem Amt einen Wechsel zwischen Bürotätigkeit, Kontakt zur Bevölkerung und Arbeit in der Politik gibt. Deswegen muss sich ein Bezirksvorsteher von klar umrissenen Tagesabläufen ganz frei machen können.
Ein guter Vorgesetzter ist nicht unbedingt der beste Sachbearbeiter.
Wie würde die Arbeit im Rathaus mit Ihnen als Chef aussehen?
Jeder Mitarbeiter sollte die Freiheit haben, sich zu entfalten und die Arbeit auf seine Art zu machen. Natürlich gibt es Grundregeln, an die man sich halten muss. Aber ein guter Vorgesetzter ist nicht unbedingt der beste Sachbearbeiter, sondern jemand, der seinen Leuten ihren Freiraum lässt und sie so unterstützt, dass sie mit ihren Möglichkeiten zum besten Ergebnis kommen. Strenge Vorgaben sind sinnlos, weil man sie nicht auf jeden überstülpen kann.
Sie haben im Zuge Ihrer Bewerbung bereits Seminare besucht, in denen Sie sich über die Aufgaben eines Bürgermeisters und über die Gemeindeordnung Baden-Württemberg informiert haben. Sie scheinen ja sehr optimistisch zu sein, dass Sie die Stelle bekommen.
Ja, sonst hätte ich es nicht angefangen. Ich gehe immer vom Bestmöglichen aus, weil ich ein sehr positiver und optimistischer Mensch bin. Ich hätte mich natürlich nicht beworben, wenn eine reine Verwaltungstätigkeit gefordert wäre. Aber ich wusste, was auf mich zukommt, und dann gehe ich mit 100-prozentiger Leistung und Transparenz an die Sache heran. Die Entscheidung, ob ich die Stelle bekomme, müssen andere Menschen treffen. Falls die sich gegen mich entscheiden, falle ich aber nicht in ein tiefes Loch, denn dann geht es bei mir wie gewohnt weiter.