„Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen alle differenzierter über unsere Gefühle sprechen können“
Das triggert mich! Therapiesprache im Alltag
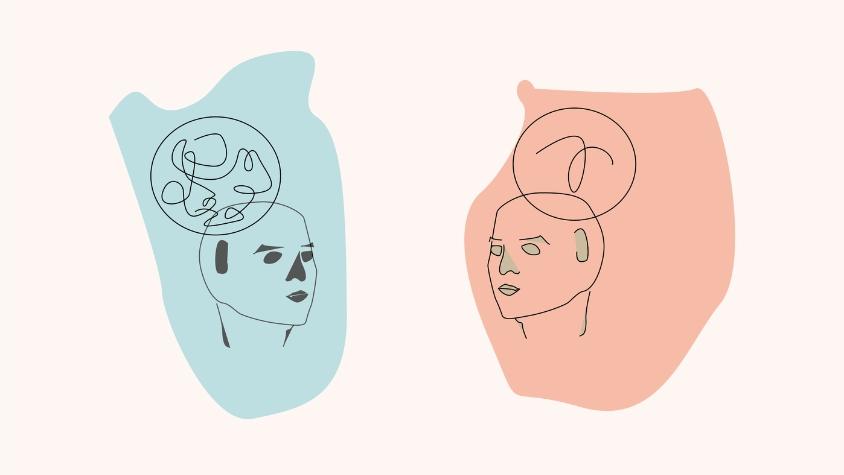
„Mein Exfreund ist so ein Narzisst – die Beziehung war einfach nur toxisch“, klagt eine Stimme in der Menge. Ein anderer sagt: „Hör auf zu schmatzen – das triggert mich voll!“. Und in der nächsten Instagram Story ist jemand „total traumatisiert“ vom Flugchaos. Ob die Person davon wohl wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hat oder doch nur erschöpft und genervt war, ist natürlich reine Spekulation. Fakt ist: Im Alltag begegnen uns immer häufiger Begriffe, die eigentlich aus der Therapiesprache stammen. Dieses Phänomen ist auch bekannt unter dem Label des sogenannten „Therapy Speak“.
Therapy-What?
Eine anerkannte Definition für den „Therapiesprech“ gibt es nicht. Der Begriff ist relativ neu und ein Produkt der Internetwelt. Was jedoch gilt: Bei diesem Sprachtrend werden Worte oder ganze Sätze aus dem psychotherapeutischen Bereich, für alltägliche Situationen oder Gefühle verwendet. Eine medizinische Diagnose liegt dabei meistens nicht vor.
Aber wie kommt dieser Fachjargon überhaupt in unseren Alltag? Laut der deutschen Psychotherapeuten Vereinigung waren 2021 über 2,7 Millionen Menschen in Deutschland in psychotherapeutischer Behandlung und die Nachfrage und der Bedarf steigen weiterhin an. Kein Wunder also, dass die mentale Gesundheit immer mehr in den Fokus rückt. Mit zunehmendem Wissen über ein Thema steigt auch die Tendenz, entsprechende Begriffe und Konzepte in die Alltagskommunikation zu integrieren. Aber der „Therapiesprech“ wird nicht nur aus der eigenen Therapiestunde aufgeschnappt. Auch die sozialen Medien leisten ihren Beitrag bei der Verbreitung von Trends. Anke Werani, Professorin für Psycholinguistik, erklärt, dass das vor allem damit zu tun hat, dass sie „eine größere Reichweite haben als persönliche Kontakte. Neue Wörter oder Ausdrücke können über soziale Medien in sehr kurzer Zeit viral gehen.“
TikTok, Instagram und Co.
Der Blick auf die eigenen Social-Media-Apps offenbart: Inhalte rund um die mentale Gesundheit boomen. Allein der #toxic zählt satte zwei Millionen und #triggered über sechs Millionen Beiträge auf Instagram – von ernsten Diskussionen bis hin zu ironischen Reels oder Memes. Würden wir die verwendete Sprache im Internet als verlässlichen Indikator ansehen, dann wären wir wohl besser über unsere Psyche aufgeklärt denn je. Immer mehr Content Creator*innen springen auf den Zug auf. Während die Einen zur Aufklärung und Information beitragen wollen, wittern die Anderen das große Business.
Egal ob die Absichten dahinter gut oder schlecht sind: Besonders junge Menschen beeinflusst der Trend maßgeblich. Eleanor Morgan, Autorin und Psychologin, schreibt im Guardian von den Missverständnissen, die bei dieser Zielgruppe auftreten können. Während sie mühelos über Begriffe wie triggern, Gaslighting oder Narzissmus sprechen, tun sie sich oft schwer damit, Emotionen wie Wut oder Angst klar zu benennen.
Werani erklärt sich dieses Phänomen folgendermaßen: „Was uns vertraut ist, kommt uns auch einfacher vor auszudrücken.“ Körperliche Phänomene, wie zum Beispiel Angst, sind viel individueller und vielen Menschen wohl weniger vertraut und damit auch schwerer sprachlich auszudrücken. „Dazu kommt, dass sich unsere mentalen Konzepte vermutlich ähnlicher sind als die körperlichen Phänomene, die daher umfassender beschrieben werden müssen.“
Doch gerade das genaue Beschreiben und Ergründen von Gefühlen und Emotionen ist ein zentraler Aspekt der Therapie. Außerdem machen die uns so geläufigen Phrasen nur einen Bruchteil dieser Gespräche aus: Jede Beziehung zwischen Therapeut*in und Klient*in ist einzigartig und hat seinen ganz eigenen intimen Kontext, betont die Psychologin Morgan in ihrem Text. Was passiert also, wenn plötzlich selbsternannte Expert*innen solche Begriffe ohne diesen Kontext predigen?
Enttabuisierung oder doch eher Banalisierung?
Martina Rudolph-Zeller ist psychologische Beraterin und Leiterin der Telefonseelsorge in Stuttgart. Sie findet es gut, dass das Thema mentale Gesundheit mittlerweile so viel Aufmerksamkeit bekommt. Außerdem gäbe es neben den vielen oberflächlichen und kommerziellen Inhalten durchaus auch seriöse und großartig aufgearbeitete Beiträge in den sozialen Medien. Sie mahnt jedoch auch zur Vorsicht: Worte oder Situationen können durch den Einzug der Therapiesprache in den Alltag eine Schwere bekommen, die sie vielleicht gar nicht haben müssten. „Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen alle differenzierter über unsere Gefühle sprechen können“ erklärt Rudolph-Zeller. Denn nicht jeder Schreck ist ein Trauma. Oder im Kleineren gesprochen: Nicht jeder Kopfschmerz ist eine Migräne. Es ist wichtig, zwischen einem behandlungsbedürftigen Krankheitsbild und einem vorübergehenden Zustand zu unterscheiden, betont sie.
Damit einher geht auch das Problem, dass wir anhand der Wortform allein nicht erkennen können, ob das Wort im Sinne eines Alltagsbegriffs oder eines wissenschaftlichen Begriffs gebraucht wird, erklärt Werani, die Professorin für Psycholinguistik. Sie äußert Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verharmlosung der Krankheitsbilder. Rudolph-Zeller sieht die Gefahr dagegen weniger in der Banalisierung, sondern eher in der Überdramatisierung von Situationen.
Macht uns Therapy Speak egoistisch?
Therapiesprache wirkt sich jedoch auch auf eine ganz andere, zwischenmenschliche Ebene aus. So kann sie zum Beispiel Hilfestellung bieten, um unsere Bedürfnisse und Gefühle zu kommunizieren. Wenn unser Gegenüber mit diesen Begriffen allerdings so gar nichts anzufangen weiß, kann das auch schnell mal nach hinten losgehen – wie dieser viel kritisierte Tweet eines Beziehungscoach 2019 zeigt:
Empathie sieht anders aus. Der „Therapiesprech“ wirkt hier egoistisch, geskriptet und fast schon entwaffnend. Ein intellektuell verpacktes: „Wenn du das nicht akzeptierst, bist du Schuld, wenn es mir schlecht geht.“ Auch Werani sieht eine Gefahr in der Oberflächlichkeit, jedoch stärker aufgrund der verkürzten und verallgemeinerten Ausdrücke. Diese bieten gar nicht erst die Chance authentisch zu berichten, wie es einem wirklich geht. Dafür braucht es laut der Psycholinguistin „entfaltete Sprache und damit Zeit“.
Sensiblerer Umgang als Lösung
Ein sensibler Umgang mit Begriffen aus der Psychotherapie ist also wichtig und das auf allen Ebenen. Rudolph-Zeller plädiert deshalb dafür, auch zwischen den Zeilen zu hören. Das ist großer Bestandteil der Telefonseelsorge, lässt sich aber genauso gut auf unseren Alltag übertragen. Wenn sich also das nächste Mal jemand über seinen toxischen Ex beschwert, lohnt es sich vielleicht genauer hinzuhören, denn der Trend „Therapy Speak“ wird so schnell nicht verschwinden.











