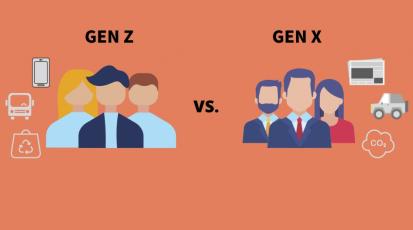„Ich konnte dem Therapeuten zwar alles erzählen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass eine Therapie stattfindet. Ich hab ihm halt Sachen erzählt und das wars.“
Der schwere Weg zur Zufriedenheit

Psychische Erkrankungen sind ein gesellschaftliches Problem, das häufig unterschätzt wird. Auch Thomas bemerkte nach seinem dritten Studium das etwas nicht stimmt. Obwohl ihm bewusst war, wie wichtig Lernen und Anwesenheit für den Abschluss des Studiums sind, konnte er sich nicht dazu aufraffen. Für ihn gab es keine rationale Erklärung, was ihn davon abhält. Im Gespräch mit einer Hochschulpsychologin stellte sich heraus, dass Thomas Probleme hat. Mit Mitte 20 entschied er sich für einen erneuten Studienabbruch. Auch wenn ihm bewusst war, dass er diese psychischen Probleme angehen sollte, brauchte es die Ermutigung einer guten Freundin, um sich für einen Therapieplatz zu bemühen. Diese Freundin hat selbst eine psychische Erkrankung und suchte das Gespräch mit Thomas. Ihn zu überzeugen mit Therapierenden zu sprechen habe sehr lange gedauert. Ohne diesen Impuls hätte er sich wohl bis heute nicht mit Therapeut*innen getroffen.
„Depressionen werden bei Männern schlechter erkannt, weil die Symptome sich oft von denen bei Frauen unterscheiden“, sagt Susanne Berwanger, Psychotherapeutin und Vorstandsmitglied des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Männer leiden laut Berwanger häufiger unter Schlafstörungen und sind gereizter, was ein großer Kontrast zu der klassischen Depression sei, die bei Frauen diagnostiziert werde. „Darüber hinaus ist das Suizidrisiko bei Männern höher“, sagt Berwanger. Laut Statistischem Bundesamt sind 76 Prozent der Suizide im Jahr 2019 durch Männer durchgeführt worden. Ob dieses Phänomen durch klassische Geschlechterrollen bestärkt wird, könne Berwanger nicht sagen, da es dazu keine belastbaren Zahlen gebe. Klar sei aber, dass die Stigmatisierung der Erkrankung aufhören müsse. Gerade deshalb ist es Thomas wichtig, dass offener mit Depressionen umgegangen wird. Schließlich seien das Menschen, die eine behandelbare Erkrankung haben, aber oft nicht in Behandlung kommen, da sie Angst haben stigmatisiert zu werden. Auch in seinem beruflichen Umfeld habe er eine junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Vorbehalte nicht in Therapie möchte. „Da versuche ich die Rolle meiner Freundin einzunehmen, die mir den nötigen Schubs gegeben hat", sagt Thomas.
Bevor es für Thomas zur Psychotherapie ging, hat er mit einem Sozialarbeiter der Caritas gesprochen. Sein ehemaliger Arbeitgeber finanzierte die Beratungsgespräche für Mitarbeiter*innen. In typisch schwäbischer Manier dachte sich Thomas, wenn es für ihn umsonst sei, könne er das Angebot ja annehmen. Es werde ja nicht schaden, sich mit einer neutralen Person auszutauschen. Da diese Gespräche ihn aber nicht weiterbrachten, suchte er sich seine erste Therapiestelle. Aber auch der Therapeut konnte Thomas nicht helfen. „Ich konnte dem Therapeuten zwar alles erzählen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass eine Therapie stattfindet. Ich habe ihm halt Sachen erzählt und das wars“, erzählt Thomas.
Weil Thomas mit der monotonen Arbeit, die er nach seinem Studienabbruch aufgenommen hatte, nicht zufrieden war, hat er erneut ein Studium begonnen. „Mein Ziel war, etwas aus mir zu machen, aber ich habe schnell gemerkt, dass das ohne Hilfe nichts wird. Ich konnte mich einfach nicht für das Studium motivieren“, erzählt Thomas. Nach dem ersten Semester hat er sich dann eine neue Therapeutin gesucht. Bei dieser Therapeutin konnten erste Erfolge erzielt werden. „Mir wurde klar, dass ich mich in größeren Gruppen nicht kleinmachen muss. Ich bin nicht schlechter als meine Mitstudierenden. Durch dieses Bewusstsein hatte ich nicht mehr so viel Druck, wenn ich mit vielen Studierenden zu tun hatte“, sagt Thomas. Auch heute merkt man, dass er sich viel Zeit nimmt, um seine Sätze zu bilden. Ob aus fehlendem Selbstbewusstsein oder wegen des Verlangens, niemanden Unrecht zu tun, kann er nicht sagen. Er möchte nichts Falsches sagen.
Auf den*die richtige*n Therapeut*in kommt es an
Auch wenn er mit dieser Therapeutin einige Erfolge erzielte, fühlte er sich bei ihr nicht so richtig wohl. Er hat die Therapie bei ihr trotzdem fortgesetzt, bis er die Grenze von der Krankenkasse gezahlten Therapiestunden erreicht hatte. Also musste ein*e neue*r Therapeut*in her. Da er sich mittlerweile deutlich mehr mit seiner Psyche und der Therapie an sich auseinandergesetzt hatte, war es ihm wichtig, eine*n Therapeut*in zu finden, der oder die sich nicht nur mit Verhaltenstherapie, sondern auch mit tiefenpsychologischer und analytischer Psychotherapie auskennt. Seine früheren Therapeut*innen waren auf Verhaltenstherapie spezialisiert und bei beiden hatte Thomas nicht das Gefühl, dass wesentliche Schritte auf seinem Weg der Besserung erzielt wurden.
Verhaltenstherapie: Menschen lernen ihr Verhalten im Laufe des Lebens durch eigene Erfahrungen. Wenn die erlernten Muster zu Problemen führen, kann eine psychische Erkrankung entstehen. Deshalb werden negative Muster durch positive ersetzt. In der Therapie werden Methoden erarbeitet, die im Alltag helfen sollen auf diese positiven Muster zurückzugreifen.
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: Hat sich aus der psychoanalytischen Therapie entwickelt. Das Problem kann auf ein innerpsychischer Konflikt zurückgeführt werden. Bei der Behandlung konzentriert man sich auf die Aufarbeitung des sogenannten „Zentralen Konflikts“ und sucht auf dieser Basis nach möglichen Ursachen in der Persönlichkeit oder der Vergangenheit des Patienten.
Analytische Psychotherapie: Diese Therapie geht auf österreichischen Arzt und Psychologen Sigmund Freud zurück und ist die älteste Form der Psychotherapie. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Varianten dieser Psychotherapieform entwickelt, die jedoch in Ihrem Verständnis der Entstehung psychischer Erkrankungen größtenteils übereinstimmen. Verdrängte Gefühle und Erinnerungen sollen bewusst werden, die eine gesunde Entwicklung blockieren. Die Ursachen und Lösungen der Probleme liegen in der Vergangenheit des Patienten. In der Therapie sollen diese prägenden Konflikte wieder durchlebt werden, um sie zu verarbeiten.
Mehr Informationen zu Therapie und weitere Therapieformen gibt es hier.
Mit der neuen Therapeutin hatte er doppeltes Glück: Er bekam ohne Wartezeit den ersten Termin. Der Unterschied zu seinen bisherigen Therapeut*innen sei wie Tag und Nacht gewesen. Sie vermittelt ihm nie das Gefühl, dass seine Entscheidungen schlecht oder gar falsch seien. „Oft habe ich meine Therapeutin um ihre Meinung zu bestimmten Themen gefragt. Aber im Endeffekt wollte ich nur eine Bestätigung oder gar Erlaubnis haben“, sagt Thomas. Diese Unsicherheit konnte er in seiner Therapie schrittweise abbauen. Durch die Therapie wurde ihm deutlich, wie wichtig Selbstreflexion ist. Geht es ihm in dieser Woche gut oder schlecht, soll er sich vor Augen führen, woran das liegt. Sind die Umstände einmal bekannt, könne er die Situation beeinflussen. Das ist eine der vielen Stufen, die Thomas auf seinem Weg in die Zufriedenheit nehmen muss. Ob die therapeutische Spezialisierung schlussendlich der Grund für den Therapieerfolg ist, könne Thomas nicht genau sagen. Sicher ist aber, dass diese Therapeutin für ihn die Richtige ist.
Mehr von Thomas gibt es im unten verlinkten Audiofeature.
* Der Name des Protagonisten wurde von der Redaktion geändert.