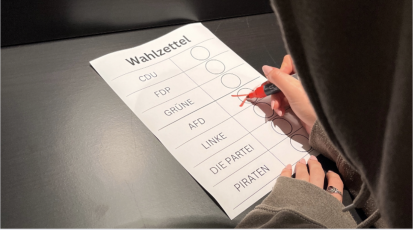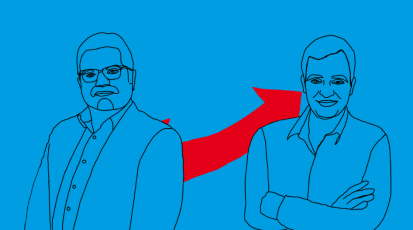Groß zu holen, gab's nichts, außer eine Kasse, in der höchstens 200 Euro waren. Aber das war nicht ihr Ziel, ihr Ziel war es, uns Angst zu machen. Hakenkreuze und SS-Blitze schmückten die Wände. Aus den aufgeschlitzten Behandlungsmatten quoll die Wolle nur so heraus. Umgetretene Regale und zerstörte Deko gaben dem Bild den letzten Schliff. Sie verwüsteten sorgfältig jeden Raum – drei Stockwerke, 20 Räume. Doch die Geschichte meines Vaters, die meiner Familie, beginnt in einer ganz anderen Welt.
Von der Sonne in den Schnee
Adanalıoğlu im Südosten der Türkei: Orangenbäume und Sonnenschein. Für meinen Vater die Idylle. Für meinen Onkel ein Stück seines Herzens. Die Welt war schön, erzählt er. Er wuchs auf einem kleinen Bauernhof auf. Als Klassenbester seiner Schule in der benachbarten Küstenstadt Mersin plagten ihn noch keine Sorgen. Das hat er mir schon oft erzählt. Blaues Meer, alte Männer spielen im Kaffee Karten und seine beiden Großeltern, die ihn wie einen Sohn aufzogen, formten langsam aus ihm einen jungen Mann. Der Rest meiner Familie war nicht mehr im Heimatdorf, denn 1968 hatte meine Großmutter das kleine Dorf zwischen Adana und Mersin verlassen. Es hieß, Deutschland brauche Arbeitskräfte – die klassische Migrationsgeschichte. Rund 867.000 Türken sind nach Deutschland gekommen, mehr als die Hälfte ist aber schnell wieder zurück in die Heimat. Mit 12 Jahren verließ auch mein Vater widerwillig seine Heimat. Aus der Sonne in den Schnee – er und seine fünf Geschwister mussten sich in einem Land behaupten, dass sie nie wirklich willkommen hieß. Mein Vater fragte meine Großmutter, ob die Wolken vom Himmel fielen, denn der Schnee war ihm so fremd wie sein neues Zuhause. Obwohl er eigentlich ein Streber war, kam er wie alle türkischen Kinder in die Hauptschule – selbst die Lehrkräfte waren Türken. Integration war nie das Ziel; die Gastarbeitenden sollten nach getaner Arbeit in die Heimat zurück. Höchstens an der Ladenkasse kamen sich die Menschen näher. Es bildete sich eine Parallelgesellschaft, die sich klar von der deutschen Kultur abgrenzt. „Kanaken“ nannte man sie und mein Vater sagte dazu: „Ich wusste erst, als ich nach Deutschland kam, dass ich ein Türke bin.“ Doch wie durch ein Wunder haben es alle von ihnen geschafft, etwas aus sich zu machen. Obwohl ihr Herz eigentlich noch in Mersin hing und es ihnen nicht immer leicht gemacht wurde. Aus dem Gastarbeiter wurde der ewige, erduldete Gast. Meine Familie versuchte alles, um dem Gastgeber Deutschland nicht auf die Füße zu treten. Ihnen wurde ständig das Gefühl gegeben, sich schämen zu müssen, Türken zu sein. Besuchten sie die Heimat, mussten sie sich schämen, Deutsche zu sein.
Die neuen Deutschen
Meine Geschwister, Cousins, Cousinen und ich sind, wie die meisten Türkischstämmigen in Deutschland, hier geboren worden. Teilweise war eines der Elternteile Deutsch. Ich war im Kindergarten, ging zur Schule, spielte Fußball und feier Weihnachten. Eigentlich unterscheidet mich nichts von meinen Freunden außer die Haare und die Nase. Trotzdem schien ich den Fluch des Gasts nie so richtig loszuwerden.
Das Dorf, in welchem ich aufgewachsen bin, konnte mit Migrant*innen nicht viel anfangen. Das weiß ich aus Biergartengesprächen und den Zahlen der Kommunalwahlen, die eindeutig immer blauer werden. Rassistische Bemerkungen waren für uns normal. Abgetan wurde es von den Leuten mit einem „Ihr seid anders, ihr seid nicht so“, gut zu wissen. Aber das ist ehrlich gesagt nicht mal so schlimm. Schlimm wird es, wenn sich die Einbrüche, eingeschlagenen Auto Scheiben oder aufgeschlitzten Autoreifen häufen. Ich war noch klein, als wir dort lebten, also habe ich da nicht alles mitbekommen oder überhaupt verstanden, aber mir wurde im Laufe der Zeit immer mehr bewusst, nicht willkommen geheißen zu sein. Je älter ich werde, desto klarer wird mir gemacht, anders zu sein.
Ein Ortsschild weiter
Sommer, wir leben mittlerweile einen Ort weiter in einer Kleinstadt am Berg. Nur noch ein Relikt unserer Existenz befindet sich im Kern des Dorfs. Das Geschäft meines Vaters. Doch selbst das war offenbar einigen noch zu viel. In der Nacht zum Vatertag haben sich wohl einige Leute gefunden, die auch diese letzte Fährte unserer Familie weghaben möchten. Ich stelle mir gerne vor, wie sie, wie in einem Lucky-Luke-Comic in einer Reihe, größenabwärts auf Zehenspitzen in schwarzer Kleidung zum Eingang des Geschäfts schleichen und die Tür geschwind aufbrechen. Wie sie in den Räumen sind und völlig ungezügelt voller Zorn das Haus verwüsten – das kann ich mir nur schwer vorstellen. All das ist geschehen, während wir ruhig schliefen. Aus dem Schlaf gerissen, sind wir also zum Geschäft gefahren, weil eine Angestellte morgens beim Aufschließen den Schock ihres Lebens erleben musste. Sie rief uns an. Ich fuhr zusammen mit meiner Familie zum Geschäft. Vor dem Eingang tummelten sich viele Menschen – und das um 8 Uhr morgens am Vatertag. Wir drängten uns an den Leuten vorbei. Ich konnte meinen Augen kaum glauben. Mit starrem Blick taste ich mich langsam rein. Früher hatten wir in diesem Haus gelebt. Nun glich der Eingang einem Spukhaus. So sehr ich es auch probiert habe, konnte ich keinen Schritt hineinsetzen, denn der Anblick durch die Tür hatte mir schon gereicht: Ein rotes, verlaufenes Hakenkreuz auf einer weißen Tür, inmitten einer chaotischen Kulisse, nein inmitten von Verwüstung. Während meine Stiefmutter und mein Vater mit der Polizei sprachen, saß ich sprachlos im Auto, denn gerade war das noch ein ferner Traum. Denke ich heute an diesen Tag zurück, findet in mir ein Wechselspiel aus tiefer Trauer, Angst, Wut und Lachen statt. Ich lache, weil die Vorstellung von so etwas so absurd und fern ist.
Die wahre Zerstörung war nicht der Vandalismus, sie fand in uns allen statt. Ruhige Nächte gab es nicht mehr, und wohin wir auch gingen, verfolgte uns der Schatten der Verwüstung. Ein ungutes Gefühl im Rücken, als würde man beobachtet werden, von Menschen, deren Gesicht man nicht kennt, denn wer die Täter waren, haben wir nie erfahren. Ich sprinte am selben Tag noch mit zittrigen Beinen zum Bahngleis, wo mein Zug raus aus dem Dorf hält. Währenddessen lauschte ich einem kaum verständlichen Gespräch zweier Jungs. Sie murmelten irgendwas vor sich hin. Ich war mir jedoch sicher, dass es um den Einbruch gehen musste. Jedes Gesicht, das ich seither gesehen habe, hätte das sein können, das ich nicht kenne. Unser größter Wunsch war nicht Vergeltung oder Schadensersatz. Es war zu wissen, welcher Mensch dahintersteckt. Wie schon gesagt haben wir uns in besagter Nacht nichtsahnend im Bett gewälzt. Seitdem Seitdem wissen wir, dass bei jedem Mal, wenn wir die Augen wieder schließen und glauben, im Frieden zu sein, die Nazis kommen könnten.
Bis heute bleibt das Thema Tabu. Auf der Suche nach Bildern des Tatorts sagte mein Vater zu mir: „Ich will das nicht wieder sehen, unser Leben geht weiter.“ Unser größter Wunsch ist, zu wissen. Unser Zweitgrößter zu vergessen. Fahre ich am Ortsschild des kleinen Dorfes vorbei, wird mir übel, und am liebsten würde ich sofort umdrehen. Wie die Menschen das dort empfanden oder ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, weiß ich nicht. Früher sollte es der Eingang zu meiner Heimat sein, heute fühlt er sich an wie der Eingang zur Hölle.
Nichts Halbes und nichts Ganzes
Es gibt Organisationen, die Opfer von rassistischen Gewalttaten beraten. M*power ist eine davon. Die Mitarbeitenden erklären mir, dass sich allerdings nur die wenigsten Opfer Hilfe holen. Sie erklären mir, dass mögliche Folgen rassistischer Gewalt Traumata, Angstzustände, Paranoia und Identitätsprobleme sind. Besonders der letzte Punkt spielt für mich eine wichtige Rolle. Ich bin nie Halbdeutscher, sondern immer Halbtürke. Meine deutsche Familie, die seit Jahrhunderten hier lebt, ist auch ein wichtiger Teil von mir. Unsere Generation ist heimatlos. Auch meine Freunde und Verwandten, die zwar „volle“ Türken sind, haben schon lange jeden Bezug zu dem, was die Türkei heute ist, verloren. Sie leben aber gleichzeitig in einer Welt, die sie als Teil der Türkei zählt. Seit diesem Einbruch wurde ein Keil zwischen meiner Familie und Deutschland geschlagen. Wo man sich zuvor zumindest als Deutscher fühlte, wurde man plötzlich eines Besseren belehrt. Es fällt schwer, sich mit dem Ort, an dem man großgeworden ist, zu identifizieren, und immer wieder höre ich meinen Großvater sagen: „Vertraue niemals einem Deutschen“. Das Band zu Deutschland wurde für meinen Vater nach Jahrzehnten letztendlich zerschlagen. Der Wunsch, in ein anderes Land zu ziehen, wächst seither Tag für Tag in ihm – „Sohn verlass Deutschland, geh irgendwo hin wo du sicher bist“. Rassismus und Anfeindungen verschwinden nicht einfach so. M*power erklärte mir: „Auswirkungen von Rassismus gehen in generationales Erbe über. Auch heute noch werden ausländische Kinder anders groß. Sie haben andere Lebens- und Erfahrungswelten, ebenso wie ihre Eltern. Damit reicht die Wirkung von Rassismus über das eigene Leben hinaus.“
Wie eine schräge Nase oder Geheimratsecken wird auch der Rassismus vererbt, sowohl an die Täter wie auch an die Opfer. Rassismus stirbt nicht mit den Menschen, er heftet sich wie ein Fluch an den nächst Besten. Denn älter werden heißt manchmal zu erkennen, dass manche Freunde zu viel von ihren Eltern in sich tragen und Stück für Stück das werden, was sie eigentlich verurteilten: Mein alter Freund, der vor mir über „Türken“ lästert, ist ein Beispiel dafür. Auch wie einer von 6 wegen seiner Hautfarbe festgenommen wurde oder wie unser Bekannter, der niemals eine Wohnung bekommen wird; „Wir wollen keinen Türken in der Nachbarschaft“. Viele Migranten Kids, tragen den aufgestauten Hass von mittlerweile drei Generationen in sich herum, bis sie eines Tages platzen. Die letzten EU-Wahlen zeigen, wie wir Deutschen langsam auseinanderdriften und wie immer mehr Menschen eine Partei unterstützen, die eine Gesellschaft rassisch unterscheidet und bewertet. Die meisten Menschen in meinem Umfeld scheinen nicht so zu sein, im Gegenteil, sie bestürzen die Situation gleichermaßen.
Trotzdem spüre ich langsam, wie ich immer noch den Koffer, mit dem meine Großmutter herkam, rumschleppe. Ich habe ihn nie ausgepackt, denn auch ich soll wohl für immer ein Gast bleiben.