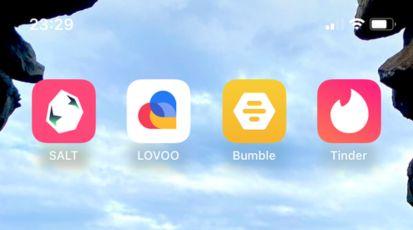Wenn das eigene Zuhause zum Alptraum wird

Hasan sitzt auf einem Klappstuhl in der kleinen Nische am Ende des langen Flurs. Die Nische ist 180 Zentimeter breit und 80 Zentimeter lang. Vor ihm steht ein Beistelltisch, quer passt er genau in die Nische. Monitor und Laptop auf dem Tisch – so arbeitet Hasan im Homeoffice.
Der 44-jährige Familienvater Hasan Brunnenkant arbeitet als Business Innovation Manager beim Sparkassenverlag. Hasan entwickelt Apps für seine Firma. „Ich bin Erfinder“, so erklärt er immer seinen Kindern seinen Beruf. Erfinderisch muss Hasan auch mit der Situation zuhause umgehen. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, sieben und fünf Jahre, lebt er in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Stuttgart. Im letzten Frühjahr waren alle Familienmitglieder zuhause. Jeder hatte sich in eine Ecke zurückgezogen. Seine Frau arbeitete mit dem Laptop am Esszimmertisch und Hasan damals im Schlafzimmer. Bevor er in den Flur zog, war der kleine Beistelltisch mit Monitor hinter der Tür im Schlafzimmer untergebracht. Hasan erinnert sich: „Da habe ich mich dann reingequetscht, es war extrem eng. Wenn man dort mal acht Stunden sitzt, bekommt man schnell Rückenschmerzen und Beklemmungen, das kann man eigentlich nicht vertragen. Nach sechs Wochen habe ich dann gemerkt: Ich muss aus diesem Zimmer raus.“ Eigentlich hat sich die Familie eine schöne Wohnung zum Wohlfühlen ausgesucht: 85 Quadratmeter, Garten, Balkon, gute Ausstattung, schönes Interieur. Aber all das verschwimmt für Hasan, wenn er in der Ecke sitzt und in den schwarzen Kasten guckt. Er nimmt nur noch die negativen Seiten der Wohnung wahr: Es ist eng, man kann nirgends ausweichen, man kann sich nicht zurückziehen, keine Tür, die man hinter sich zu ziehen kann.
Seit November 2020 gilt der zweite Lockdown, das bedeutet wieder eingeschränkte Kontakt- und Freizeitmöglichkeiten. Wohnpsychologe Uwe Linke erklärt: „Problematisch ist an den Veränderungen der Wohnsituationen durch die Corona-Pandemie, dass wir sehr viel mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen und vermehrt Alkohol und Zucker konsumieren. Das sind Anzeichen, dass Depressionen stark zunehmen." Menschen sind soziale Wesen, die auf Austausch mit Kollegen, oder auch anderen, zufälligen Begegnungen angewiesen sind. „Die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf eine völlig veränderte Situation einstellen mussten, gleicht einem Auffahrunfall“, so Linke.
Seit den Corona-Maßnahmen wird bei den Brunnenkants abwechselnd im Homeoffice gearbeitet. Hasans Frau arbeitet für die Stadt Stuttgart als Kita-Integrierte-Praxisberatung in der Kindertageseinrichtung. „Bin wieder zuhause!“, kommt ihre Stimme von der Eingangstür. Es ist Mittagspause. Hasan packt seine Arbeitssachen, zugleich begrüßt und verabschiedet er seine Frau und fährt mit dem Auto zur Arbeit. Arbeitgeber müssen soweit möglich Homeoffice anbieten, das wurde mit der am 27.01.2021 in Kraft getretenen Corona-Arbeitsschutzverordnung festgelegt. Für Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten können, haben die Arbeitgeber durch geeignete Maßnahmen den gleichwertigen Schutz sicherzustellen. „Weil ich mit dem Auto komme und sonst keiner im Betrieb ist, hat mir meine Firma eingeräumt, dass ich ins Büro gehen kann. Ich wurde aber gebeten, das auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, erzählt Hasan.
Insgesamt arbeitet aktuell fast jeder Zweite zumindest teilweise im Homeoffice, wie aus der Bitkom Research Studie hervorgeht. „Nachdem viele sich zuhause einen Arbeitsplatz einrichten mussten, wird einem auch ein anderes Thema bewusst: das Bedürfnis nach Abgrenzung“, so Wohnpsychologe Linke. Wer arbeiten muss, braucht dafür gutes Licht, eine lärmfreie Umgebung und vor allem einen Zeitrahmen, indem er ohne Unterbrechung konzentriert an einer Sache arbeiten kann.
Enges Zusammenleben auf zu kleinem Raum
Die Kinder flitzen durch die Wohnung. Der Große ruft: „Papa, kannst du mir bei meinen Schulsachen helfen?“ Kurz darauf steht sein kleiner Bruder neben ihm: „Ich brauch ein neues Ausmalbild!“ Schnell werden Schulaufgaben besprochen und ein Ausmalbild aus dem Internet ausgedruckt. Ein Weckruf geht am Laptop los: 10 Uhr, ein Online-Meeting mit dem Abteilungsleiter steht an. Hasan schickt seine Kinder zum Spielen. Dieses Mal läuft das Meeting ungestört ab. „Die Kinder können natürlich jederzeit kommen, sie wissen ja nicht, mit wem ich gerade einen Termin habe“, bemerkt Hasan verständnisvoll. Trotzdem belastet die Schließung der Schulen, Kitas und Jugendfarmen die Eltern. Man sitzt zu viel aufeinander.
„Durch die fehlenden Strukturen von außen fällt es uns schwerer, mit uns selbst, aber auch in Beziehungen zurechtzukommen“ meint Linke. Familien und Beziehungspartner sind plötzlich 24 Stunden zusammen. Vorhandene Spannungen werden dadurch zunehmend verstärkt. Gleichzeitig wird in der „Copsy-Studie“ des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) aufgezeigt, dass Familien, die über einen guten Zusammenhalt berichten und viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, besser mit den Belastungen in der Pandemie zurechtkommen.
Im Frühjahr 2020 konnte sich die Familie Brunnenkant leichter aus dem Weg gehen. Die Kinder spielten im Garten oder auf dem Hof. Abends verabschiedete sich abwechselnd ein Elternteil für ein paar Stunden und nahm sich eine kurze Auszeit. Doch mit den zunehmenden Beschränkungen wurde die Situation immer schwieriger zu bewältigen. Hasan erzählt: „Durch die Ausgangssperre musste man sich schon irgendwie konzentrieren, dass man seine Arbeit macht, seine Kinder versorgt, seiner Frau was Gutes tut und dann aber trotzdem noch ein paar Minuten für sich hat – noch mal rausgeht und frische Luft tankt.“
40 Prozent der Mieter finden ihre Wohnsituation nach den Corona-Erfahrungen nicht mehr optimal, so das Ergebnis der LBS Research Studie. Junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters standen während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie besonders unter Druck. In der NAKO-Gesundheitsstudie nannten die Befragten deutlich stärkere Symptome von Angst, Stress und Depressionen. Homeoffice, Homeschooling, Infektionen mit dem Coronavirus und Einschränkungen in der Freizeit und der privaten Kontakte haben im Frühjahr die psychische Belastung verstärkt.

Die Flucht ins Wohnheimzimmer
Auch Sabrina Pjede, 22, denkt in einem Wohnheim in Stuttgart ans Umziehen. Sie sitzt auf ihrem Bett und lernt für die nächste Klausur. Neben ihr steht der Minikühlschrank mit Kaffeemaschine und Wasserkocher obendrauf. Zwischen Bettende und Kühlschrank lagert Altwäsche in einem Beutel. Auf der gegenüberliegenden Seite steht ein schmaler, hölzerner Kleiderschrank, in den nicht viele Klamotten hineinpassen. Sie hat zudem ein Waschbecken in ihrem Zimmer, auf dem Spülmittel und Zahnputzsachen stehen. Auf einer Kommode liegt ein Geschirrhandtuch, auf dem gewaschenes Geschirr trocknet. In der Kommode hat sie Pfannen, Töpfe, Lebensmittel sowie persönliche und schulische Unterlagen eingeräumt. Neben dem „Küchenschrank“ steht Sabrinas Schminkecke. Seitlich davon ist die Balkontür, die nicht so leicht zu öffnen ist, ohne, dass die an der Tür aufgehängten Handtücher und Jacken herunterfallen. „Mein Zimmer ist überladen. In der Gemeinschaftsküche und dem Gemeinschaftsbad ist kaum Platz, um Sachen zu verstauen und die wenigen Abstellmöglichkeiten, die es gibt, sind leider sehr unsauber“, klagt Sabrina. In den 16 Quadratmetern versucht Sabrina so gut es geht, all ihre Sachen zu verstauen.
Zu Beginn ihrer Ausbildung suchte Sabrina nach einer Wohnmöglichkeit in der Nähe ihres Ausbildungsbetriebs. Nach Wohnpsychologe Linke reicht einem Menschen im Prinzip ein Raum mit den notwenigen Möbeln, um darin zu leben. „Typabhängig macht uns eine schlechte Behausung allerdings früher oder später krank, weil wir darin nur überleben, aber keine Ruhe und Geborgenheit finden.“
In der Flurgemeinschaft lebt Sabrina mit fünf weiteren Mitbewohnern zusammen. Ein Mitbewohner kommt ihr im Flur entgegen. Schweigendes Vorbeigehen. „Das hier ist eine reine Zweck-WG“, sagt Sabrina, netter Plausch und fröhliches Zusammenkommen finden hier nicht statt. Sabrina betritt die Küche, eine Mitbewohnerin steht am Herd und kocht ihr Mittagessen: „Hey, hast du schon gesehen, überall liegen Zigarettenstummel in der Wohnung, der neue Mitbewohner hat hier auch noch nie richtig sauber gemacht.“ Sabrina murmelt zustimmend und verabschiedet sich schnell wieder. „Sobald etwas dreckig ist, wird jemand Neues beschuldigt. Das ist auch die einzige Kommunikation, die hier stattfindet“, beteuert Sabrina ärgerlich. Sabrina atmet erleichtert, als sie wieder in ihrem Zimmer ankommt, ohne einer weiteren Person auf dem Flur begegnet zu sein. Durch Homeoffice und Homeschooling verkriecht sie sich die meiste Zeit in ihrem Zimmer, geht nur raus, wenn es unbedingt sein muss. „Und wenn, dann beeile ich mich auch sehr, wieder zurück ins Zimmer zu kommen, um dem Dreck und dem Stress mit den Mitbewohnern möglichst zu entkommen“, erläutert Sabrina. Ein Zuhause zum Wohlfühlen ist das für Sabrina nicht. Linke meint: „Wohlfühlen beinhaltet, dass man sich willkommen fühlt und die Tür zu einer Heimat öffnet, die von einem persönlich beeinflusst ist und zu einem passt wie eine dritte Haut.“ Letztendlich ist ein echtes Zuhause ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, wo die Bedürfnisse nach Nähe und Gemeinschaft erfüllt werden und an dem man sich zurückziehen kann, um neue Kraft zu tanken.

Lange möchte Sabrina nicht mehr in ihrem Wohnheim bleiben. Zu Beginn ihrer Ausbildung suchte sie nach einer günstigen Wohnmöglichkeit, doch jetzt möchte sie eine eigene kleine Wohnung mieten, in der sie sich wohlfühlt.
Die Familie Brunnenkant hat bereits eine größere Wohnung in Stuttgart gefunden, nicht weit weg von der jetzigen Wohnung. Im Mai ist der Umzug geplant. Bis dahin hoffen sie, dass sich die Corona-Maßnahmen lockern, denn der Umzug stellt durch die Pandemie eine weitere Herausforderung dar.