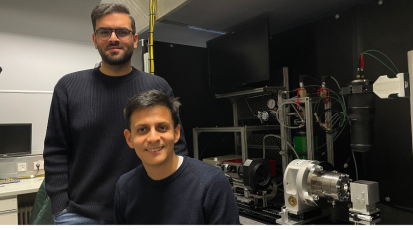Wenn Korallen zu Geistern werden

Als ich im Sommer 2017 zum ersten Mal in den Indischen Ozean tauchte und erwartete, die kunterbunte Unterwasserwelt vorzufinden, die Filme wie „Findet Nemo“ mir ausgemalt hatten, sah ich stattdessen einen Friedhof.
Die Vorfreude war immens gewesen. Von der kleinen Tauch-Station vom Hotel waren es nur wenige Schritte bis zum Strand. Das Hotel selbst lag in einer größeren Bucht im Südosten von Mauritius. Geschützt von einem Riff, war das hellblaue Wasser in der Bucht nicht sehr tief und beherbergte viele Korallen. Ideal für Sporttaucher*innen, die den Urlaub unter Wasser verbringen wollten.
Fertig angezogen marschierten meine Familie und ich von der Basis los, gingen durch eine Allee von Palmen und näherten uns dem Tauchspot vom Land aus. Mir war unter dem Neoprenanzug sehr heiß, ich wollte endlich ins tiefe Wasser waten und abtauchen. Das Gewicht sämtlicher Ausrüstung lastete auf meinen Schultern. Die Schläuche meiner Atemregler und für meine Taucherjacke baumelten bei jedem Schritt umher; jede*r von uns Taucher*innen sah aus wie ein Weihnachtsbaum.
Der erste Tauchgang
Im hüfthohen Wasser zogen wir uns die Flossen an, bliesen die Luftblase in unserer Jacke voll, damit wir nicht untergingen, und paddelten dann zu einer orangenen, mit Flechten bewachsenen Boje. Der Tauchmeister, der uns den Tauchgang über führen würde, gab das Zeichen zum Abtauchen: Daumen runter. Die Masken saßen. Ich steckte mir den Atemregler in den Mund, der ein bisschen nach Neopren und Salz schmeckt, und atme noch einmal an der Oberfläche ein und aus. Man hört sich wirklich wie Darth Vader an. Und mit meinen rauschend-dröhnenden Atemgängen im Ohr ließ ich die Luft aus meiner Jacke und tauchte ab.
Das Wasser war angenehm warm. Die Sonne war durch die Wolken durchgebrochen, im Meer war alles ummantelt von einem grünlichen Schleier. Vereinzelte Fische schwammen umher, dicht über den Korallen pulsierte ein Schwarm. Die Leine der Boje war in einem kleinen Sandplatz betoniert, der wie ein kahler Fleck in der Landschaft stand. Ringsum breiteten sich aberhunderte von Steinkorallen aus. Sie bedeckten den ganzen Boden in der Bucht. Ich schwebte im Wasser über ihnen und drehte meinen Kopf in alle Richtungen. Die Korallenformationen sahen von oben aus wie ein nie enden wollender Wald.
Aber der Wald war ausgeblichen. Wie dürre Geister stachen die steinernen Kalkzweige der Korallen in alle Richtungen. Der Boden war übersät mit Trümmerteilen, abgebrochenen Korallenstücken, Splittern von Kalkschalen und ausgeblichenen -ästen.

Von wegen war hier die Unterwasserwelt bunt! Klar, während meiner Ausbildung zum Sporttaucher hatte ich gelernt, dass Wasser mit zunehmender Tiefe Farben verschluckt. Zuerst verschwindet Rot, dann verblassen allmählich Gelb und Grün, bis alles Blau und schließlich dunkel wird. Beim Briefing vorher hatte der Tauchführer gesagt, es würde maximal sieben Meter tief werden. So tief waren wir also nicht, dass uns das Wasser die Farbenpracht nahm.
Trotzdem tauchte ich ein wenig näher heran und holte meine Lampe hervor. Ich drehte sie auf volle Streuung und leuchtete die braun-weißlichen Korallen an. Leider gab ihnen das Licht nicht die rote Strahlkraft zurück. Wie in einem Geisterwald, oder auf einem Friedhof, wiegten die toten Kalkskelette in der sanften Strömung. Wie ausgedörrtes Holz oder eingefrorene Grashalme an Land. An ihnen war kein pulsierendes Leben, frische Polypenblüten oder vitale, sprießende Verästelungen gab es nicht.
Korallen sind sensible Lebenswesen
Auf den Kalkskeletten sitzen normalerweise unzählige winzige Nesseltierchen, die Polypen. Zu Tausenden zusammengeschlossen bilden sie die schön anzusehenden Steinkorallen, indem sie Kalk ausscheiden und darauf wieder als Knospen wachsen. Über die Zeit errichten sie so riesige Siedlungen aus immerzu wachsenden Kalkschichten. Die Steinkorallen der Gattung Acropora, die vor meinen Augen den Boden bedecken und dabei wie winzige Geweihe aussehen, legen pro Jahr gut 16 Zentimeter zu.
Ermöglicht wird das rege Wachstum der verästelten Korallen durch die Symbiose mit Algen, die in den Polypenzellen leben. Durch diese Win-win-Beziehung wird das von den Korallen freigesetzte und im Meerwasser gelöste C02 von den Algen umgewandelt: Mittels der Fotosynthese erzeugen die Algen aus dem Kohlenstoffdioxid Sauerstoff und andere Nährstoffe. Diese Nährstoffe kommen den Korallen zugute, die dadurch leichter ihre Kalkskelette ausbilden können, während die Algen in den Polypen geschützt sind.
Die Acropora, die wir sahen, lebten nicht mehr in diesem Einklang. Ihre Farbe war von stumpfer Bräune und sie wirkten verblasst. Nur ganz selten erspähte ich eine kleine Ansammlung an Korallen, die noch frischer schienen: Ihr Farbton war von einem satteren Rostbraun, und ein feines, weiches Netz aus weißen Polypenspitzen überzogen ihr Kalkskelett. Aber diese Ausnahmen bestätigten leider nur die Regel.
Der Tauchführer tauchte mit uns durch die zerklüfteten Korallensiedlungen. Der Anblick blieb trostlos. Allzu viele Fische sahen wir nicht. Mir fielen kleinere Schwärme auf, deren kleine Fische schwarz-weiß gestreift waren und mich an das Adidas-Logo erinnerten. Sie hielten sich nahe an dem leblosen Gerippe der Korallen und verschwanden in den verzweigten Schächten und Windungen, als unsere Tauchgruppe sich näherte. Wir hielten kurz an, weil unser Tauchführer einen Feuerfisch entdeckt hatte. Er versteckte sich in einer höhlenartigen Einbuchtung und dümpelte im Schatten vor sich hin. Wir hielten Abstand und störten ihn nicht. Ich fand, er sah wie die anderen Fische irgendwie traurig aus, und irgendwie allein. Vielleicht auch ein wenig verwahrlost.
Obwohl die Korallen nur knapp ein Prozent des gesamten Meeresbodens bedecken, tummeln sich an denen von ihnen gebildeten Riffen etwa 25 Prozent allen maritimen Lebens. Ich weiß nicht, ob dieser Tauchgang die Zahlen bestätigen kann, aber mir fällt auf, wie nahe sich die Fische an den Korallen halten. Manche knabbern auch an den Kalkskeletten. Bewusst wird mir dadurch nur die immense Bedeutung, die Korallen für das Ökosystem im Meer haben. Sie dienen vielen kleineren Fischen als Lebensraum, für manche wie die Papageienfische oder die Falterfische auch als Nahrungsversorgung. Deren Bestände haben wiederum empfindlichen Einfluss auf die Balance der Ökosysteme im Meer.
Auch interessant
Nach dem Tauchgang waren wir zurück an der Tauchbasis. Die bestand aus einer kleinen Hütte, die gerade so genug Platz für einen in die Jahre gekommenenen und etwas röchelnden Kompressor für die Luftflaschen bot. Daneben hingen ein paar Leih-Tauchjacken, die nach Neopren und Salz rochen. Hinter dem Haus lag eine steinerne Wasserwanne, in der wir unsere ganzen Sachen wuschen. Währenddessen redeten wir mit der Chefin der Basis – sie lächelte uns aufmunternd an. Sie war nicht mitgetaucht, konnte aber aus unseren Gesichtern ablesen, was wir dachten.
Es liegt an der Wärme, erklärte sie.
Wird es zu warm, ab einer Temperatur von etwa 29 bis 30 Grad Celsius, nehmen die in den Korallen lebenden Algenzellen Schaden und büßen ihre Fähigkeit ein, Fotosynthese zu betreiben. Dazu werden sie für die Polypen giftig. Die Korallen stoßen deshalb die Algen ab und verlieren ihre Farbe, sie „bleichen“ aus. Ohne diese Algen überleben diese Korallen nicht mehr lange. Von Art zu Art ist es unterschiedlich, innerhalb einiger Wochen aber sterben die meisten ab.
Ich hätte lieber einen dickeren Neoprenanzug getragen und die bunten Geweihkorallen betrachtet, als bei angenehmen Badetemperaturen über das Trümmerfeld zu schweben.
Da das Riff außerdem recht klein und es an der tiefsten Stelle nicht sonderlich weit hinuntergeht, ist dieser Marine Park so etwas wie eine Tourist*innenattraktion. Nahe den Stränden gibt es einige verschiedene Hotels, an den Stränden selbst – weil sie niemandem gehören – liegen überall kleine Motorboote vor Anker.
Die Chefin sagte, dass die vielen Boote ebenfalls den Korallen zusetzen. Vor allem bei Ebbe liegen die Korallen so nahe an der Oberfläche, dass zu früh eingeschaltete Propeller die Kalkskelette abbrechen. Während wir darüber sprachen, sauste weiter draußen in der Lagune ein Motorboot vorbei, das eine lange Leine hinter sich herzog, an der ein Mensch hing und Wasserski fuhr.
Mit ihren Booten machen einheimische Kapitäne ihr Geschäft: Sie warten auf dem Strand auf Tourist*innen. Die Kapitäne tragen legere T-Shirts und verspiegelte Sonnenbrillen. Manche von ihnen gehen auf die Hotelgäste zu, sprechen gutes Englisch und locken mit wabbeligen Laminatbildern von schönen Orten. Viele der Boote haben auch einen verheißungsvollen Namen, oder zumindest einen, der bei den Tourist*innen Anklang finden soll, ein Schiffchen trägt etwa den blitzenden Schriftzug „Harry Potter“ auf dem Rumpf.
Auch uns quatschte einer an, als wir uns auf den Weg zum nächsten Tauchspot machten. Er sagte, draußen, außerhalb des Riffes, gebe es viele gute Stellen zum Tauchen. Wir lächelten, gingen aber weiter. Ich dachte bei mir, früher wäre das Riff selbst auch gut zum Tauchen gewesen, bis die Boote und das wärmer gewordene Meer die Korallen zerstörten. Jetzt bräuchte man die Boote, um hinauszufahren und noch die verbliebenen Orte anzusehen.
Versenkte Attraktionen
Für den zweiten Tauchgang gebe es mehr für uns zu sehen, hatten die Chefin und der Tauchführer uns versprochen. Als wir hinabtauchten und den mit reinem Sand bedeckten Boden absuchten, sehen wir, was sie gemeint hatten: Überall waren versenkte Statuen. Wir tauchten etwas herum und sahen uns die Götzenbilder an. Viele Korallen und damit viele Fische gab es nicht zu entdecken.

Ein schwacher Trost, fand ich. Wenn es die Natur nicht mehr gab, warf man eben eigene Attraktionen ins Meer, um es den Taucher*innen schmackhaft zu machen. Dabei musste ich daran denken, mit welcher Verantwortung wir als Sporttaucher*innen hier unter Wasser unterwegs waren und was uns unsere Tauchlehrer*innen damals bei der Ausbildung mitgegeben hatten: Als Taucher*innen waren wir als Beobachter*innen Teil des Meeres. Nur gucken, nicht anfassen – dieses Mantra war uns eingebläut worden.
Wie schädlich Tauchtourist*innen sein konnten, das hat unsere Tauchlehrerin anhand eines Beispiels in Australien illustriert: Riesige Taucher*innenjachten, die auf dem Great Barrier Reef herumfuhren und zu Heerscharen die Taucher*innentouristen ins Meer ließen. Damals, bevor der Schutz des größten Riffes der Welt mehr ins öffentliche Bewusstsein rückte, hatten auch die Taucher*innen einen Anteil an dessen Niedergang.
Aktuelle Studien bescheinigen dem Great Barrier Reef eine gewaltige Menge an ausgebleichten Korallen. Es brennt also nicht nur im Indischen Ozean, sondern an allen Orten der Weltmeere. Schuld daran ist der Klimawandel. Durch die Erderwärmung wird es in den Meeren zu warm. Wenn es global um 2 Grad Celsius wärmer werden würde, so fürchten Expert*innen, werden 99 Prozent aller Korallenbestände zerstört. Seit den 1950er Jahren hat sich der Bestand laut Studien um die Hälfte reduziert. Auch im Indische Ozean, in dem wir gerade tauchten, drohen die Korallenriffe abzusterben.
Ganz hoffnungslos ist es allerdings nicht. Nach einer Bleiche können sich an Riffen die Korallen wieder ansiedeln. Beim Great Barrier Reef gehen Forscher*innen zehn Jahren aus, die es bräuchte, damit die Bestände sich wieder erholten. Allein im letzten Jahrzehnt wurde Australien von mehreren Hitzewellen heimgesucht, die die Korallenriffe weiter ausbleichen lassen.
Jedoch gibt es einige Arten von Steinkorallen, die gegen Hitze beständiger zu sein scheinen. Sie wachsen nach wie vor. Forscher*innen und Meeresschützer*innen züchten sie in kleinen Kolonien an, um sie dann wieder an den Riffen anzusiedeln. Bevor wir wieder auftauchen, zeigt auch unser Tauchführer uns ein kleines Gitternetz, an dem kleinere Fragmente von Korallen neue Polypen austreiben sollen.

Was von der Natur übrig bleibt
Für den letzten Tauchgang fahren wir auf das offene Meer hinaus und verlassen das Riff. Dieses Mal nahmen wir auch ein Boot. Unser Kapitän, von etwas schmächtiger Statur und mit einem Zopf unter der Baseballcap, fuhr vorsichtig über die Korallen. Keiner von den Einheimischen schien die Hoffnung aufgegeben zu haben, zumindest verhielten sich viele noch so, als wären die Korallen nicht alle schon sehr verblichen. Und wahrscheinlich waren sie im Recht, denn selbst ausgeblichene Korallen könnten sich ja wieder erholen.
Außerhalb vom Riff jagte er das Boot übers freie Meer, wir schanzten über die Wellen. Die Sonne erhitzte die schwarzen Neoprenanzüge derart, dass die aufspritzende Gischt angenehm kühlte. Der Kapitän lachte, als wir uns so sehr festhielten, normalerweise, so sagte er, wären die Wellen viel extremer.
Scheinbar mitten im Nirgendwo hielt er an. Es gab keine Boje, kein gar nichts. Nur die bei sich belassene Natur. Der Kapitän meinte, er habe sich an den Baumformationen am Festland orientiert und so die Stelle gefunden.
Wir sprangen hinein. Vor uns erschloss sich eine neue Welt. In 30 Metern Tiefe lag der riesige Steinkoloss, eine Art Felsformation mit dem hübschen Namen „Lobster Cave“. Der Steinblock ist so farbenprächtig wie die Filme es damals verhießen hatten. Im Licht unserer Taschenlampen erstrahlte er in satten Rottönen. Überall sind kräftige Flechten, Anemonen, Korallenskelette in verschiedenen Formen und Farben, die Polypen sind von hellem Weiß, die Seepflanzen kräuseln sich im Wellengang. Der Wellengang war sehr heftig, selbst unten wurden wir wie auf einer Hollywood-Schaukel ständig hin- und hergetrieben.

In den Felsspalten verbargen sich viel mehr Fische. Unten auf dem Sand krebste eine Languste entlang. Fischschwärme beäugten uns neugierig. Kaiserfische schwebten majestätisch vorüber. Eine Muräne gähnte uns aus einer kleinen Höhle an. Dieser Stein war wie ein einziges, riesiges, pulsierendes Herz voller Leben, rot und leuchtend.
Es gab also noch diese schönen Orte. Ich dachte an das Korallengerippe, das abgebrochen auf dem Boden des Riffes lag. Dieses Felsherz schlug noch, aber für wie lange? Bis heute sind vier weitere Sommer vergangen. 2022, als ich erneut den Marine Park besuchte, gab es die Tauchbasis vom Hotel nicht mehr.
Ich frage mich, ob in dem Riff, das wir draußen im Meer gesehen haben, das Felsenherz noch schlägt, die Korallen noch leben und wachsen – oder ob ich damals in 2017 einen letzten Blick geworfen habe, auf eine wunderschöne, verschwindende Welt.