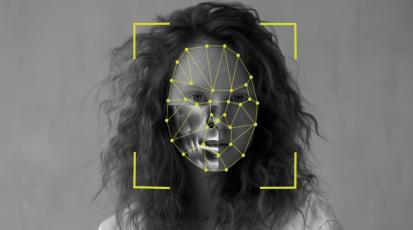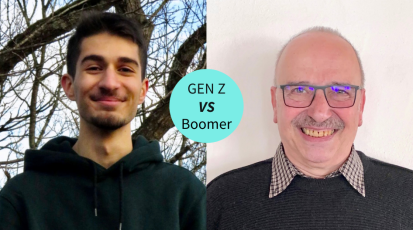„Vielleicht klingt es makaber, aber für mich ist es der schönste Job der Welt.“
„Wartet nicht, sondern lebt!“
Sie arbeiten seit mehr als fünf Jahren mit Palliativpatient*innen. Wie fühlen Sie sich, wenn eine*r Ihrer Patient*innen stirbt?
Es sind mehrere Gefühle, die einen dann überkommen. Ich baue ganz unterschiedliche Verbindungen zu den Patient*innen auf. Das hängt davon ab, wie lange und wie intensiv die Begleitung war. Manchmal betreue ich Personen oder Familien über ein Jahr lang. Manchmal ist es aber auch nur ein einziger Tag, weil der*die Betreute früher verstirbt, als man glaubte. Klar, ich fühle oft mit. Gerade wenn Kinder involviert sind. Jeder Tod ist ein Abschied. Jemand geht und kehrt nicht zurück. Das macht einfach traurig.
Wie schaffen Sie es, bei so intimem Kontakt eine Distanz zu den Patient*innen zu wahren?
Das geht schon. Das geht sogar ziemlich gut. Doch dafür ist es sehr wichtig, den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl zu kennen. Mitleid bringt den Patient*innen nichts, Mitgefühl hilft aber sehr. Angehörige sind meist zu nah dran, weswegen sie schnell Mitleid empfinden. Als Fachperson kann ich den Fokus auf das Mitgefühl richten. Und nur so kann ich den Menschen helfen. Das ist nicht immer einfach, doch man lernt mit der Zeit, damit umzugehen. Es gibt auch Weiterbildungen, die einen dabei unterstützen.
Was ist Palliativpsychologie?
Palliativpsycholog*innen betreuen Menschen, die unheilbar krank sind. Das Ziel der Versorgung ist es, die Lebensqualität und Selbstbestimmung der Palliativpatient*innen aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dadurch soll ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod ermöglicht werden. Nicht alle Sterbenden beanspruchen palliativpsychologische Unterstützung. Eine Weiterbildung im Bereich der sogenannten „Palliative Care” wird für Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen angeboten. Sie beinhaltet mehrere Unterrichtseinheiten und fachspezifische Kurse und erfordert Praxiserfahrung oder Hospitation in einer palliativen Einrichtung.
Quelle: Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung, Karin Speh
Demnach stellen wir beim Mitleid eine emotionale Bindung zu der betroffenen Person her. Beim Mitgefühl halten wir emotionalen Abstand und bleiben objektiv. Nach Ihrem Psychologiestudium haben Sie sich im onkologischen und palliativen Bereich weitergebildet. Wie sehen palliative Weiterbildungen konkret aus?
Die Weiterbildungen richten sich an Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen, die im palliativen Bereich arbeiten wollen. Man besucht Unterrichtseinheiten und fachspezifische Kurse. Im Zuge meiner Selbstständigkeit fing ich an, mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung zusammenzuarbeiten, und entschied mich dann dazu, die Weiterbildung zur Palliativpsychologin zu machen. Es gibt auch Weiterbildungen, die sich gezielt mit der Psychohygiene, der Lehre zum Schutz der psychischen Gesundheit, beschäftigen. Dort wird einem nahegelegt, sich einen Ausgleich neben dem Beruf zu schaffen. Urlaub ist da zum Beispiel sehr wichtig. Man braucht Zeit für sich selbst, um Erfahrenes zu verarbeiten und um nicht rund um die Uhr an Begleitende denken zu müssen.
Hatten Sie schon einmal Zweifel an Ihrer Berufswahl?
In keinerlei Weise. Ich sehe es als Geschenk, jemanden am Ende seines Lebens begleiten zu dürfen. Dabei unterscheidet sich die Palliativpsychologie von der klassischen Therapie: Man hat nicht unendlich viel verfügbare Zeit – im Zweifel muss es schnell gehen. Das ist aber eine schöne Herausforderung, wie ich finde. Vielleicht klingt es makaber, aber für mich ist es der schönste Job der Welt. Auch wenn er einen emotional belasten kann. Es wäre für mich das Schlimmste, irgendwann abzustumpfen und über Patient*innen zu denken: „Ist doch nur ein*e Weitere*r, der*die stirbt.“
Was hat Sie an der Arbeit mit Sterbenden gereizt?
Nach meinem Psychologiestudium wusste ich, dass ich in den therapeutischen Bereich möchte. Ich habe während des Studiums in einer Rehabilitationsklinik und anschließend in einem Akutkrankenhaus gearbeitet. Dort habe ich erstmals onkologische Patientinnen begleitet. Frauen, die zum Beispiel vor Kurzem die Diagnose Brustkrebs erhielten, die frisch operiert wurden oder gerade erst die Chemotherapie begonnen haben. Auch mit palliativen Patient*innen kam ich mehr und mehr in Kontakt. Außerdem gab es einen Sterbefall in meiner Familie, wodurch ich selbst in Berührung mit dem Tod kam. Das hat meine Entscheidung, in den palliativen Bereich zu gehen, bestärkt.
Finden Sie es wichtig, den Tod in das Leben miteinzubeziehen?
Hinsichtlich Patientenvollmachten und Generalverfügungen macht es Sinn, sich schon zu Lebzeiten mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Das kann eine große Entlastung für Angehörige sein. Es sollte klargemacht werden: Was möchte ich, wenn ich meinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann, und wie möchte ich es. Ich persönlich habe meine Wünsche klar formuliert – von vorausgeplanten Behandlungsvorstellungen bis hin zur Beerdigung.
Wie kann man sein Leben gestalten, um später weniger Probleme mit dem Tod zu haben?
Das mag jetzt zwar simpel klingen. Aber ich denke, es ist hilfreich, sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte. Auch wenn das in der Umsetzung manchmal herausfordernd ist. Es fängt mit den kleinen Dingen an, zum Beispiel jetzt zur Weihnachtszeit. Dann sehe ich den fünften Lebkuchen und frage mich, ob ich ihn wirklich noch essen soll. Ich sage euch: Esst ihn! Esst ihn, weil er euch schmeckt und er euch in diesem Moment glücklich macht. Und wenn ihr eine Person gerne habt, dann sagt es ihr – worauf noch warten? Das ist wirklich etwas, was ich aus meiner beruflichen Erfahrung mitgeben kann. Wartet nicht auf etwas, sondern lebt. Plant und überdenkt nicht nur, sondern tut es.