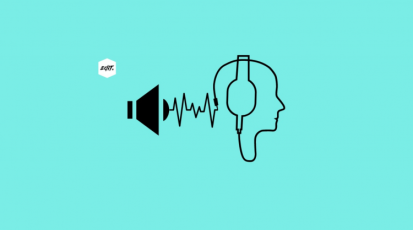„Auch Afrikaner haben ein Recht auf Bildung und kulturellen Austausch.“
„Die glücklichste Zeit meines Lebens“

Es ist 10 Uhr morgens und die Sonne scheint bereits aus voller Kraft. Es riecht nach verbranntem Holz und nasser Erde. Aaron Kanyesigye und ich sitzen im Schatten einer großen Bananenpalme. Sein Gesicht ist gezeichnet vom Leben, eine kleine Narbe ziert seine linke Wange, Schweißperlen laufen seine Schläfen hinunter. Er lächelt mich an und scheint sich über meinen Besuch zu freuen.
Aaron wurde 1989 in einem Dorf im Westen Ugandas geboren. Seine Eltern waren Farmer und besaßen eine Bananenplantage, um die er sich mit seinen sechs Geschwistern kümmerte. Da seine Familie wenig Geld verdiente, schlug sich Aaron nach der Schule mit Gelegenheitsjobs durch, bis er irgendwann die Möglichkeit bekam, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Deutschland zu absolvieren.
Aaron, wie fühlt es sich an, wieder Deutsch zu sprechen?
Ungewohnt. Ich habe extra geübt, bevor du gekommen bist (lacht).
Wir befinden uns gerade im ugandischen Dorf Bushenyi, deinem Geburtsort und jetzigem zu Hause. Wie kam es dazu, dass du 2018 diesen Ort verlassen hast und für ein Jahr nach Deutschland gegangen bist?
Ich war Anfang zwanzig, da lernte ich Abby kennen. Sie ist Koordinatorin einer deutschen NGO, die ihren Standort in meinem Dorf hat. Ich brauchte wirklich dringend einen Job, also stellte sich mich als Tourguide für die Besucher an.
Kam so dein Interesse an Deutschland zustande?
Kann man so sagen. Siehst du den Berg da drüben? (Er zeigt auf eine große, von Teeplantagen umsäumte Bergkette in der Ferne). Das ist der Imberezi-Hill, dort habe ich oft Touren hingemacht. Eines Tages stand ich mit einer Gruppe auf der Spitze des Berges und sie fingen an, mir von Deutschland zu erzählen. Sie redeten von Stränden, Wind und (überlegt) ... Weinreben! Ja genau, sie redeten so viel von Weinreben (lacht). Ich war fasziniert von diesem Land und wollte mich mit den Besuchern besser unterhalten können, also beschloss ich Deutsch zu lernen.
Ging das denn so einfach in diesem kleinen ugandischen Dorf?
Ja, die freiwilligen Helfer der NGO haben mir Unterricht gegeben. Irgendwann war ich so gut in der Sprache, dass mich Abby fragte, ob ich nicht Lust hätte, als Freiwilliger für ein Jahr nach Deutschland zu gehen, also bewarb ich mich und wurde 2017 tatsächlich für ein Projekt in Norddeutschland genommen.
Als du dann im April 2017 in Norddeutschland angekommen bist, was waren deine ersten Eindrücke?
Alles war anders – die Autos, das Wetter, die Gebäude. Zum Glück hatte ich eine tolle Gastfamilie, die sich um mich gekümmert hat. Schon gleich in meiner ersten Woche haben sie mir ganz Kjel gezeigt.
Kjel? Ist das eine Stadt?
Ja, kennst du sie nicht?
Ich glaube nicht nein.
Sie ist ganz im Norden, direkt am Wasser.
Ah Kiel!
(lacht) Ja, genau Kiel.
Wie genau sah deine Arbeit als FÖJler in Kiel aus?
Ich habe mich um den Energieverbrauch einer Kirche gekümmert. Ich hatte alle Daten im Überblick, Wasser, Strom und Gas. Wenn wir zu viel verbrauchten, habe ich überlegt, wo wir sparen können. Nebenbei besuchte ich verrückte Uni-Kurse wie agricultural economics oder sustainability work.
Während mir Aaron von diesen Dingen erzählt, leuchten seine Augen. Er spricht sehr langsam und gewählt, sucht nach den richtigen Worten, um mir alles genau beschreiben zu können.
Unterschied sich das deutsche Arbeitsleben stark von dem ugandischen?
Es war geregelter, sehr viel geregelter. In Deutschland hat alles seine Ordnung. Es gibt feste Arbeitszeiten, festes Gehalt und feste Berufe. In Uganda ist das alles lockerer. Wenn du nicht zur Arbeit kommen willst, rufst du einfach deinen Chef an und sagst: „Es regnet, ich kann nicht kommen“ (lacht).
Hast du diese kulturellen Unterschiede auch an deiner Arbeitsweise gemerkt?
Anfangs musste ich mich schon oft motivieren, so engagiert zu arbeiten wie alle anderen. Allerdings wurde ich von meinen Vorgesetzten auch oft anders behandelt als meine weißen Kollegen. Ich musste meistens die harte körperliche Arbeit erledigen, schwere Bücher tragen, schwere Kisten schleppen und so was. Ich dufte nur selten an die Maschinen und musste meine Arbeit mit den Händen erledigen. Ich glaube, sie sahen in mir den “Klischee-Afrikaner“, der aus einem armen Land kommt und sich mit dem zufriedengeben muss, was man ihm gibt.
Hast du mit deinen Vorgesetzten darüber gesprochen?
Ja, ich habe viele Gespräche mit ihnen geführt, die aber nie etwas gebracht haben. Ich glaube... (überlegt), sie haben mich nie richtig ernst genommen. Jedenfalls haben sie alle Schuld von sich gewiesen.
Wie hast du dich in solchen Momenten gefühlt?
Alleine und fremd – und ... unverstanden. Ja, unverstanden. Ich habe mich in solchen Momenten unverstanden gefühlt. Sie taten so, als gäbe es das Problem nur in meinem Kopf.
Das Strahlen in Aarons Augen ist verschwunden, auf einmal wirkt er sehr ernst. Ich merke, dass ihn dieses Thema beschäftigt, nicht erst seit unserem Gespräch. Ich frage mich, ob seine Vorgesetzten ihn bewusst so behandelt haben, ihn bewusst diskriminieren wollten. Vermutlich nicht. Vermutlich haben sie es selbst nicht einmal gemerkt und konnten Aarons Erfahrungen deswegen nicht nachvollziehen. Ich frage mich, wie oft ich schon jemanden diskriminierend behandelt habe, ohne es zu merken – einfach weil ich es nicht besser wusste. Aaron hingegen muss sich tagtäglich mit seiner Hautfarbe und Herkunft auseinandersetzen, nimmt dadurch solche Situationen deutlich wahr und reagiert sensibler darauf. Ob die Vorwürfe stimmen, kann ich in diesem Moment nicht überprüfen. Es zeigt mir jedoch, dass wir uns gegenseitig besser zuhören und verstehen sollten. Damit sich jeder in unserem Land wohlfühlen kann, müssen wir verstehen, wie andere Menschen unsere Kultur erleben, – auch wenn wir die Gründe dafür nicht immer nachvollziehen können.
Aaron, wenn du über Deutschland sprichst, dann sehe ich trotzdem immer ein Lächeln in deinem Gesicht. Hast du dich in Kiel trotz dieser Erfahrungen wohlfühlen können?
Meine Freunde haben mich immer gut behandelt. Wir sind oft zusammen an den Strand oder See gefahren, haben Bier getrunken, Musik gehört, geredet und gelacht. Insgesamt habe ich mich sehr wohlgefühlt. Ich würde sogar sagen, dass Deutschland die schönste Zeit meines Lebens war.
2018 endete dein FÖJ und du musstest wieder zurück nach Uganda fliegen. Wie hat es sich angefühlt, nach dieser intensiven Zeit wieder auf der Farm deiner Eltern zu stehen?
Die erste Woche habe ich mich gar nicht gut gefühlt, irgendwie fremd, obwohl der Ort ja meine Heimat war. Dieses Gefühl hat monatelang angehalten, ich habe das immer “Germansick“ genannt. Nach dem Tod meines Vaters habe ich den Hof übernommen, das hat mich abgelenkt. All das, was du hier siehst, gehört jetzt mir (sein Blick schweift über die kleinen, mit Bananenpalmen bepflanzten Hügel vor uns).
Wie hat deine Reise nach Deutschland dein Leben verändert?
Ich habe gelernt, wie ich mein Leben effizienter und nachhaltiger gestalten kann. Das Regenwasser sammeln wir jetzt in einer Tonne und meine Bananen verarbeite ich mittlerweile zu Gin und Bier. (Aaron greift in einen Rucksack hinter sich und zieht drei kleine Flaschen mit der Aufschrift „Bushenyi Banana Gin“ heraus). Die habe ich extra bedrucken lassen.
Wir stehen auf und gehen einen kleinen Hang hinauf zu seiner Hütte. Auf dem Weg laufen uns kleine Kinder über den Weg, Aarons Neffen, wie ich später erfahre, die ihm bei der Bananenernte helfen. Vor der Hütte bleiben wir stehen, auf dem Boden liegen Spitzhacken, Schaufeln und Eimer. Er erklärt mir, wofür er die Werkzeuge benutzt und worauf es beim Bananenanbau ankommt. Das, was er erzählt, ist interessant, doch das Glänzen in Aarons Augen beim Erzählen ist verschwunden, so als würde er nicht über sein jetziges Leben reden wollen.
Welches Gefühl kommt in dir auf, wenn du an dein Freiwilliges Ökologisches Jahr zurückdenkst?
Glück.
Macht dich dein aktuelles Leben glücklich?
Es macht meine Familie satt und meinen Vater stolz. Das ist mein Glück.