Du musst dich ändern
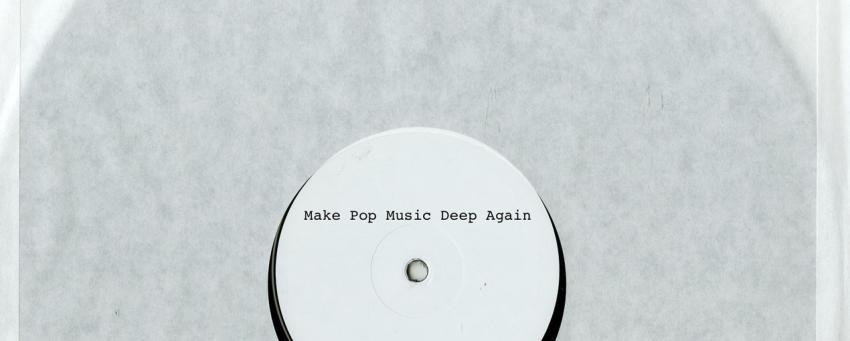
Wollte man kommerzielle Popmusik mit einem gängigen Edelstahllöffel vergleichen – es würde mehr Überschneidungen geben als Unterschiede. Beide sind im Zeitgeist der Globalisierung immer günstiger geworden, vor allem in der westlichen Welt sind sie in aller Munde, und selbst die gesellschaftliche Bedeutung der zwei zu Alltagsgegenständen mutierten Vergleichsobjekte, ist sich zum Verwechseln ähnlich: Ihre Natur, ein gewisser sozialer Standard, macht die kommerzielle Popmusik und den gängigen Edelstahllöffel insgesamt zwar unersetzlich, im Fall eines einzelnen Produkts aber vergänglich wie die Konsumbefriedigung eines deutschen Teenagers im Sommerschlussverkauf bei Primark. Das ist schade. Und zwar vor allem für die Musik.
Leicht hatte sie es ja nie. Bereits Immanuel Kant verurteilte sie in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ als schöne Kunst, als ein Spiel, als etwas, das nur für sich selbst sprechen könne, ganz so wie ein Löffel eben den Verzehr flüssiger Speisen erleichtert, nicht mehr und nicht weniger. Und obwohl es damals wie heute unzählige Beispiele gibt, die Kritikern wie jenem preußischen Philosophen und verkappten Musikhasser Wind in die Segel blasen, ist relevante Musik kein Märchen. Warum? Na, weil es Drexciya gibt.
Der Mythos Drexciya
James Marcel Stinson und Gerald Donald haben mit ihrem Gemeinschaftspseudonym Drexciya eine Welt erschaffen, die zeigt, was Musik leisten kann. Über ihrem futuristischen Techno Sound schwebt laut und deutlich eine atemberaubende Mythologie: Das Werk der beiden Afroamerikaner handelt von Unterwasserwesen, den Drexciyaner, die aus schwangeren afrikanischen Frauen geschlüpft sind, als diese, krank und scheinbar überflüssig, von kolonialen Eroberern auf der transatlantischen Deportation ins Meer geworfen wurden. Worin dabei der Unterschied zur kommerziellen Popmusik bestehen soll? Ein Wort: Kunst.
Glaubt man dem Duden, so ist die Kunst wesentlich durch eine schöpferisch gestaltete „Auseinandersetzung mit Natur und Welt“ gekennzeichnet. Und genau das tun Stinson und Donald. Sie setzen sich mit ihrer Umwelt, ihrem eigenen afroamerikanischen Erbe auseinander. Was das Ganze aber erst zu etwas Genialem, einer Schöpfung macht, ist die Art dieser Auseinandersetzung. Sie erzählen nicht einfach die furchtbaren Geschehnisse ihrer Vorfahren nach, nein. Sie verarbeiten diese, ihre Geschichte, in einem utopischen Mythos, der nicht einmal durch Songtexte, sondern durch eine spezielle, abstrahierte, maritime Klang-Ästhetik thematisiert wird. Quasi: „Show, don‘t tell“ – but without words!
Musik als Plastiklöffel
Und die kommerzielle Popmusik? Repräsentiert wird sie von unzähligen Musiker-Marionetten, die nach Trends zappeln und Zeitgeister sind. Sie wiederum werden von einem Streaming-Anbieter gesteuert, dessen global verbreitete Playlist-Kultur Musik zu einer hoch konsumbezogenen Dienstleistung gemacht hat. Schwindelerregender Preisverfall inklusive. Musik als Plastiklöffel. Punkt. Woran mag das nur liegen? Ein Querschnitt dieser Gattung zeigt Musik, die von best-selling Harmonie-Abfolgen gespickt ist, im wesentlichen aber von Lyrics getragen wird, die nichts als Alltagssituationen beschreiben: Liebe, Party, Gewalt und nochmal Liebe. Es zieht sich halt einfach an, was zusammengehört.
Na gut, Texte sollen ja auch eingängig sein, echt niemand möchte Lieder über Existentialismus mitsingen. Aber ist das dann relevant? Kant sagt: Nein. Und er hat recht. Drexciya wiederum beweist: Es geht. Musik kann relevant sein, wenn sie abstrahiert und Dinge durch Anti-Wörter, eben durch Sound, ausdrückt. Wofür sollte sie denn sonst relevant existieren? Das exakte Wiedergeben alltäglicher Zusammenhänge – dafür sind Romane einfach das bessere Format.












